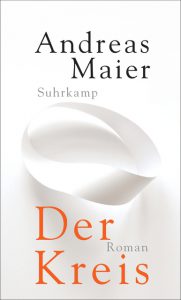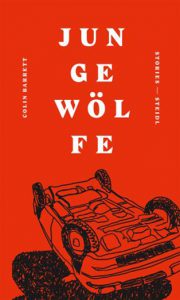Schon 2010, in seinem opulenten wie famosen Werk »Zone« hatte sich Mathias Énard einer Region verschrieben, dem Mittelmeer, machte es zum mythischer Raum, durchmaß ihn von Tanger bis Gaza und alles was von oder nach der »Zone« kommt und das, was sich in »ihr« abgespielt hatte, wurde obsessiv angesaugt und erzählerisch verarbeitet. Énard brauchte hierfür eine zwielichtige Figur, einen Kriegsverbrecher und Spion, der die Welt als eine Abfolge von Hass und Gewalt definierte und Geschichtslinien und Ereignisse von 218 vor Christus bis zu den Massakern der diversen Jugoslawien-Kriege der 1990er Jahre heranzog und miteinander verband, getreu dem Motiv der Hauptfigur, die »Geschichte ist eine Erzählung von reißenden Tieren, ein Buch, in dem auf jeder Seite Wölfe vorkommen« und so ist auch dieses Buch, atemlos, expressiv, nicht ganz ohne Punkt und Komma, sondern nur ohne Punkt; die 600 Seiten bestehen aus vielleicht zwei Dutzend abgeschlossenen Sätzen, alles steht hinter- und nebeneinander, ein Sog, der fesselte, abstieß und anzog und das alles gleichzeitig.
Und nun also »Kompass« und die Zone ist diesmal nicht das Mittelmeer sondern der Orient; es gibt also Schnittmengen aber nur geographische, aber es ist alles anders. In »Zone« wird die Hölle erzählt, personal aus Sicht einer Person, während einer mehrstündigen Zugfahrt. In »Kompass« ist es ein irdisches Paradies, evoziert von einem Ich-Erzähler, dem österreichischen Musikwissenschaftler Franz Ritter, der schlaflos in einer Nacht in Wien sein Leben rekapituliert, nicht nur aber auch weil er eine tödliche Diagnose seines Arztes erhalten hat. Erstaunlich, wie wenig man am Ende über Ritter als Person weiß. Akademisch ist er ein Schüler von Jean During und nach eigener Aussage glücklich, dem 20. Jahrhundert »widerstanden« zu haben (was sich dann bewahrheitet). Alles andere Persönliche bleibt diffus, selbst sein Alter muss man schätzen (seine Mutter ist 75), aber auf die Person Ritter kommt es eigentlich gar nicht an, obwohl das Buch auch eine Liebesgeschichte ist (übrigens keinesfalls die Geschichte einer nur gescheiterten Liebe, wie so manche Rezensenten dies hinein- oder herauslesen). Die Liebe seines Lebens, der Kompass seiner Obsession, ist die am Ende Mittvierziger Orientalistin Sarah (es bleibt beim Vornamen), eine »nomadische Akademikerin«, rothaarig, gebildet, wissensdurstig, thesenfreudig, perfekt arabisch und persisch sprechend, eine »glänzende Karriere« machend, eingeladen auf »prestigeträchtigen Kolloquien« weltweit – alles in Allem gute Voraussetzungen. Weiterlesen