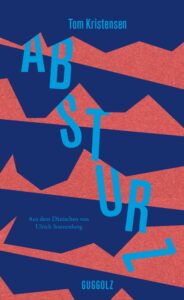Der letzte Sansevero
Mit Der letzte Sansevero liegt jetzt der fünfte und letzte Band der fiktiven Autobiographie des Giuliano di Sanservo des 1995 verstorbenen italienischen Autors Andrea Giovene vor. Es ist der Initiative des Übersetzers Moshe Kahn zu verdanken, dass dieses bemerkenswerte literarische Werk im Galiani Verlag wiederaufgelegt wurde.
Der fiktive Herzog Sansevero, 1903 geboren, Spross einer neapolitanischen Familie, wächst zusammen mit seinen Geschwistern in großbürgerlicher Atmosphäre auf. Eine Wand im Elternhaus zeigte den imposanten Stammbaum des Sansevero-Geschlechts, der bis ins 11. Jahrhundert zurückreichte. Bereits im ersten Band erinnert sich der Ich-Erzähler Giuliano rückwirkend an die kleinen Flecken und Abplatzungen am Stammbaum – sanfte Andeutung für den schleichenden Zerfall. Mit zehn Jahren endete Giulianos Kindheit (so der pathetische Befund) und er wird in eine Klosterschule verbracht. Unnahbarkeit und Kälte der Eltern bestimmen den Lebensweg des Jungen. Hinzu kommt, dass sich der Vater mit seinen Bauprojekten mutmaßlich verkalkuliert hatte. Irgendwann müssen die so stolz ausgestellten Antiquitäten verkauft werden; es droht der Bankrott. Einzig Onkel Gedeone, Staatsanwalt in Neapel, wird zum stetigen moralischen Anker, Ratgeber und Halt in Giulianos Leben.
Der letzte Band beginnt 1945 und endet mit dem letzten Eintrag Giulianos im September 1957, wenige Tage vor seinem Tod. In einem kurzen Anhang wird der Leser durch behördliche Briefe über einige offene Fragen aufgeklärt. So erfährt man, dass der sechs Jahre ältere Bruder Giulianos, Ferrante, kurz zuvor verstorben war. Da beide männlichen Nachkommen wie auch die Schwestern formal kinderlos blieben, ist die Familie nach 900 Jahren ausgestorben. Die Kinderlosigkeit wird im Laufe des Romans noch einmal befragt werden, freilich ohne endgültigen Befund.
Nach den Wirren des Krieges, die ausgiebig im vierten Band erzählt werden, kommt Giuliano wie fast immer eher zufällig in eine Position. Er wird Beamter in einem Ministerium und kümmert sich um die große Zahl der Kriegsflüchtlinge im Land. Die Behörde steht unter kommunistischer Ägide, was irgendwann zu Problemen führt, da Giuliano nicht Mitglied der Partei werden möchte. Hinzu kommt, dass seine Vorgesetzten die von ihm erfolgreich implementierten Maßnahmen für sich beanspruchen. Genau so plötzlich, wie dieses Ministerium entstand wurde es auch aufgelöst. Giuliano kehrt zum schon gebrechlichen Gedeone nach Neapel zurück und wird dort Redaktionsmitglied einer neu gegründeten Zeitung. Als im Mai 1949 der geliebte Onkel stirbt und der Herausgeber der Zeitung in den lokalen Politsumpf einzusinken droht, verlässt er Neapel, um in Guastalla so etwas wie seine Memoiren zu verfassen. Der Leser kann sich nun denken, dass er diese Memoiren in den ersten vier Bänden gelesen hat.