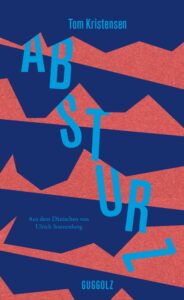Ole Jastrau ist 34 Jahre alt, verheiratet mit Johanne, hat einen dreijährigen Sohn Oluf, lebt in Kopenhagen und rezensiert dänischsprachige Bücher beim »Dagbladet«. Es ist Frühjahr 1929, ein Tag vor einer Wahl zum dänischen Folketing. Die Rezensionsexemplare stapeln sich bei ihm in der Wohnung; er muss lesen und vor allem schreiben, kann sich aber nur schwer konzentrieren. Plötzlich klingelt es an der Tür. Zunächst erkennt er den »Kommunistenbengel« Bernhard Sanders nicht, vermutlich, weil er ihn an seine eigene politische Vergangenheit erinnert. Er ist in Begleitung eines gewissen Stefan Steffensen, der eigentlich Stefani heißt, und der Sohn einer angesehenen Kopenhagener Persönlichkeit ist, des Dichters und Apothekers H. C. Stefani. Auch Steffensen scheibt Gedichte.
Die beiden bitten um Asyl für eine Nacht, um eine drohende Haftstrafe wegen Verbreitung ihrer kommunistischen Zeitschrift nicht absitzen zu müssen. Ihre Spekulation geht dahin, dass bei einem Wahlsieg der Sozialdemokraten eine allgemeine Amnestie für solche Fälle ausgesprochen werden dürfte. Die Gäste bedienen sich gerne und lassen sich noch lieber aushalten. Jastrau gilt beim blitzgescheiten Sanders als Renegat, der seine einstigen Ideale verraten habe und er läßt keine Gelegenheit aus, ihm dies mitzuteilen. Nebenbei wird das »Dagbladet« als »Lügenblatt« bezeichnet. Johanne zeigt sich von dem Besuch nicht begeistert. Sie kocht zwar für die beiden mit, reist dann jedoch mit Oluf zu den Eltern. Jastrau geht in die Redaktion.
Das ist die Ausgangssituation für Absturz, des 1930 erstmals veröffentlichten Romans des dänischen Schriftstellers Tom Kristensen (1893–1974), den der Guggolz-Verlag in einer neuen Übersetzung von Ulrich Sonnenberg herausgebracht hat. Kristensen nahm sich auf den 620 Seiten Zeit, viel Zeit. Mit großer Behutsamkeit wird der Leser in die Charakterrollen, Freund- wie Feindschaften, Ränkespiele und Geheimnisse von Journalisten und Kopenhagener Kulturschickeria herangeführt. Da ist die »Rattenwache« zum Beispiel, in der nach Feierabend Redakteure die Papierkörbe ihrer Kollegen ausleeren, zerrissene Zettel zusammensetzen und auf diese Art zuerst an Informationen über brisante Recherchen kommen oder Privates von ihren Kollegen erfahren. Die älteren Redakteure leben häufig in prekären Verhältnissen, sind desillusioniert, dem Alkohol verfallen. Ihr Stammlokal ist die »Bar des Artistes« nebst anliegendem Hotel, ein Kosmos, der hinter einer schweren, dunklen Portiere eine andere Welt offenbart, in der die gültigen Hierarchien und Wertvorstellungen außer Kraft gesetzt sind. Hier sitzen nur Männer, einige von ihnen tagaus, nachtein.
Noch ist Jastrau mit der Domestizierung seiner beiden Gäste, der Befriedung des Verhältnisses zu seiner Ehefrau und einer Rezension über ein Buch von H. C. Stefani beschäftigt. Letztere wird am Ende durch einen Verrat eines Kollegen nicht gedruckt, weil sie zu kritisch ist. Schließlich ist Stefani Kolumnist und guter Freund von Iversen, dem Chefredakteur. Immerhin druckt man ein hastig, aber gekonnt geschriebenes Gedicht von Steffensen, indem eine Sehnsucht nach Katastrophen, Zerstörung und »plötzlichem Tod« artikuliert wird. Aus dem Anmerkungsapparat erfährt man, dass es sich um ein Gedicht von Kristensen handelt. Fast fühlt man sich bei der Lektüre dieser Verse in die Zeit der Jahrhundertwende versetzt.
Immer mehr taumelt Jastrau, sinniert über sein Leben in den letzten Jahren nach. Wann hatte er eigentlich aufgehört, Gedichte zu schreiben? Wo ist das Manuskript seines unvollendeten Romans? In der Redaktion spottet man derweil, wer am konservativsten ist (und somit Karriere machen kann) und sein Schwager erklärt ihm, dass die Literaten nichts vom Leben wissen, was um sie herum gelebt wird.
Zunächst ist es nur ein Gedankenspiel: Wie wäre es, »vor die Hunde zu gehen«? Wie ist das Leben in dieser Bar, die weit weg vom wirklichen Leben ist? Und tatsächlich, für ein paar Tage war er »aus dem Tritt geraten«. Aber dann hatte er die beiden Besucher energisch der Wohnung verwiesen. Und ein Ausflug mit Johanne und dem Söhnchen bringt es wieder in die Reihe.
Das zweite der insgesamt vier Kapitel des Buches beginnt mit einem Zeitsprung von einem Jahr. Es ist Mai, Frau und Kind sind mit dem Schwager bei der Schwiegermutter auf dem Land. Ältere Kollegen versuchen wieder einmal, von Jastrau Geld zu schnorren und plötzlich steht Steffensen mit Anne Marie, dem ehemaligen Dienstmädchen seines Vaters, in der Tür. Das Verhältnis des Paares ist schwierig zu durchschauen; sie ist devot, er aufbrausend und aggressiv. Steffensen hat nichts mit der Ideologie von Sanders am Sinn, aber er verachtet Ole Jastrau trotzdem als einen »feisten Bürger«, der allenfalls dazu taugt, ihn zu verköstigen. Hier liegt paradoxerweise subkutan eine Übereinstimmung mit dem Thesen des reaktionären Schwagers.
Die Konfrontation hinterlässt Spuren. Jastrau begibt sich immer mehr in Whisky-Räusche, entdeckt bei den Trinkkumpanen vermeintlich menschliche Wärme und wacht einmal in einer Ausnüchterungszelle auf, was er als demütigend empfindet. Er kommt zwar umstandslos frei und die 15 Kronen sind leicht bezahlt. Aber was, wenn seine Frau, der umtriebige Schwager davon erführen? Oder seine Kollegen? Sanders oder Steffensen? Überhaupt steigert er sich in eine Paranoia. Die Literaturseite wurde seit drei Wochen nicht mehr veröffentlicht; die Texte nicht gedruckt. »Er sollte unsichtbar gemacht werden«, glaubt er. Iversen ist ihm gegenüber reserviert. Schließlich kommt Johanne zurück – mit Geleit ihrer Jugendliebe. Was hat sich dort abgespielt?
Es knistert zwischen den Ehepartnern. Das ist ungünstig, weil sie auf einen Empfang eingeladen sind, den man nicht versäumen sollte. Der Frack ist trotz des Frühsommers Pflicht. Man redet über Bücher und Politik, alles an der Oberfläche; nichts soll die Harmonie, den Smalltalk stören. Als Jastrau stark alkoholisiert die Meinungsfreiheit im Land in Zweifel zieht, endet die Party abrupt. Er verstreitet sich mit Johanne, steigt aus dem Wagen aus und taumelt durch die Stadt, entdeckt eine Bar, in der wie durch ein Wunder fast alle Gäste des Empfangs gestrandet sind. Der Absturz beginnt.
Aber es ist kein Absturz wie man ihn aus Trinkerballaden oder ‑geschichten kennt, er kämpft nicht mit den bösen Geistern, sehnt sich nicht nach Erlösung, wünscht und wagt nicht den Entzug (nur einmal schwört er für kurz dem Whisky ab – und ist froh, dass es nur der Whisky ist, aber auch das hält er nicht durch). Er nimmt den gesellschaftlichen (und später ökonomischen) Absturz nicht nur an, er forciert ihn. Steinchen formen sich dabei zu einem Mosaik des Überdrusses, der Ödnis. So liest er ein Interview mit einem Wirtschaftsprofessor, der das Land verlässt. Es ist eine »bodenlose Antwort«, die ihn zutiefst verstört: »Bisweilen empfindet man Ekel, ein aktiver Teilnehmer an der unseligen Entwicklung dieser Welt zu sein«, so der Professor, »und ich verspüre diesen Ekel so intensiv, dass ich meines Weges gehe.«
Fast stoisch nimmt er es hin, dass sich seine Frau scheiden lässt und er seinen Sohn vermutlich nie mehr sehen wird. Die Wohnung ist zur einer »Arche Noah mit Wrackteilen aus seiner Vergangenheit« geworden. Das Leben mit Steffensen und Anna Marie ist voller Konflikte und Exzesse. Bei Prügeleien gehen Möbel und Fenster kaputt; es herrschen Verwilderung, Rohheit, Tabak und Alkohol. Und Musik – das Grammophon mit den Jazzplatten wird stellenweise zum Fluchtpunkt. Ansonsten reibt sich Jastrau an dem wilden, einfältig daherkommenden Dichtersohn, seiner ostentativen Gleichgültigkeit und dessen rüden Umgang mit seiner Lebensgefährtin Anna Marie. Diese sei »krank«, wie es heißt, habe sich »angesteckt« (gemeint ist wohl Syphilis). Später erfährt man, dass sie sowohl mit Vater Stefani wie auch mit dem Sohn ein Verhältnis hatte. Jastrau erwägt kurz, sich mit ihr einzulassen, gibt es aber wieder auf.
»Die Konsequenzen« des Handelns, so heißt es zu Beginn, »waren außer Kraft gesetzt«. Jastrau, so etwas wie Enzensbergers Zirkulationsagent avant la lettre, ist berauscht vom Gedanken der Aufgabe seiner progressiv daherkommenden, aber eben doch bürgerlichen Existenz. Er verachtet sich selbst, kann sein Spiegelbild nicht ertragen. Seine Bewunderer bemitleidet er. Alles, was er als »Chefkritiker« geschrieben hatte, »war Lüge, durchsichtig wie eine Meinung.« Es herrsche keine Gedankenfreiheit, denn »man kann meinen, was man will, ästhetisch, ethisch…aber wenn man eine Ansicht vertritt, die ins Ökonomische eingreift, ist Schluss mit der Freiheit«. Das diffuse Ziel Jastraus ist nun, hinter die eigenen Meinungen zu kommen, »sehen, was sich dahinter verbirgt.«
Um nicht mehr korrumpierbar zu sein, kündigt er seine Stelle. Iversen, der alte Chefredakteur, erzählt als joviales Relikt aus dem 19. Jahrhundert, will dies nicht akzeptieren. Er steht für eine Welt, die bald Geschichte sein wird und für die es keinen Ersatz gibt. Instinktiv weiß Iversen das, aber er will seine Zeit schlichtweg überstehen. Das Gespräch zwischen den beiden wird fast zu einer Vater-Sohn-Versöhnungsgeschichte und es ist einer der Höhepunkte dieses Buchs, wenn Iversen dem störrischen Jastrau, der die Kündigung nicht zurücknehmen will, mit euphorischen Worten seinen Ausblick auf die Stadt zeigt, den er schon seit so vielen Jahren immer wieder neu genießt. Es ist ein Blick in eine vergehende Zeit; Iversen ist der letzte, der diese Faszination noch zu sehen vermag.
Absturz ist eine wahnwitzige, rauschhafte, großartige Auflehnungserzählung. Das morgendliche Aufwachen nach einem Gelage wird zur Orientierungssuche. Das »vor die Hunde gehen« müsse man sich auch leisten können, bekommt Jastrau einmal zu hören. Das Beispiel ist der »ewige Kjӕr«, der Dauergast der Bar, der allmorgendlich um halb fünf von den Kellnern ins Hotelbett getragen werden muss. Seine Rechnung bezahlt ein Vermögensverwalter. Aber Jastrau wird entsprechend beruhigt – bevor man vor die Hunde gehe, sterbe man.
Kristensen vermeidet all das, was bei einem ähnlichen Setting heute Standard wäre: Es gibt keine Moral, keine Verurteilung, aber auch keine Faszination oder ein latentes Engagement des Erzählers. Kristensens Jastrau lässt nichts gelten; weder ästhetische Modelle noch gesellschaftspolitische Ideologien erreichen ihn noch. Kurz gibt es einen intellektuellen Flirt mit dem Katholizismus (Steffensen wird ihm, so vermutet Jastrau später, erliegen). Immer deutlicher dominiert der Alkohol, die Geborgenheit der Mitsäufer und, als leichter Kontrapunkt, der lebensfrohe Jazz. Hier, in der »Bar des Artistes« und nur hier gab es so etwas wie Ruhe. Das Attribut des »Trinkers« nimmt er an, nein: er trägt es wie einen Orden. Ausflüge in die Welt hinter der Portiere scheitern je länger man in dieser Bar existiert umso kläglicher. Als Jastrau Kjӕr einmal auf eine Taxifahrt in den Wald mitnimmt, wird dieser fast wahnsinnig ob der einprasselnden Sinneseindrücke. Noch ist Jastrau nicht ganz abgestürzt und es gibt Menschen, die ihm helfen wollen, überraschenderweise vor allem solche, mit denen er am wenigsten rechnet. Aber er spielt mit ihnen.
Die wohltuende Unaufgeregtheit des Erzählers färbt auf den Leser ab. Derart befreit, sich selber positionieren zu müssen, schaut man auf und gibt sich dem Treiben hin. Großartig die Schilderung der Reaktionen der Figuren auf neue oder besondere Umstände, das jähe Umschlagen einer Situation, die sich häufig in einem plötzlichen Augenblinzeln zeigt. Binnen Sekunden wechseln die Stimmungen. Häufig wird die Metapher der Maske eingestreut, die notdürftig eine Fassade aufrecht erhält, aber droht, jeden Moment zusammenzubrechen. Das gilt auch für Jastrau selber. Einmal erlebt er ein »neurasthenisches Entsetzen«, als er das in der Sonne blinkende Rasiermesser des Barbiers aufblitzen sieht und für eine Sekunde glaubt, getötet zu werden. Die berühmte Szene aus einem Spielfilm von 1929 von Luis Buñuel und Salvador Dalí als Mischung aus Drohung und Erlösung.
Sebastian Guggolz erzählt im Nachwort von der Entstehung und Rezeption des Romans, der in Dänemark nach dem Erscheinen für einen veritablen Skandal sorgte. Zwar hatte Kristensen die Figuren fiktionalisiert, aber die Kopenhagener Kulturgesellschaft erkannte sich trotzdem wieder. Es war kein Schlüssel- sondern gleich ein Schlüsselbundroman, heißt es. Man ließ seinen Zorn in empörungsgetränkten Verrissen aus. Da half es wenig, dass Kristensen in der Figur Ole Jastrau seine eigenen, privaten Ereignisse gleich mit verarbeitete. Auch er war »konvertiert« vom Lyriker zum Kritiker, auch er ließ sich scheiden und zog sich nach einigen Jahren des Kritikerdaseins zurück (Jahrzehnte später wurde er noch Literaturfunktionär). Die Stimmung änderte sich erst, als aus einem enthusiastischen Brief von Knut Hamsun zitiert wurde, der Kristensens Roman über sein eigenes Werk stellte.
Lesenswert, wie Guggolz die Herausforderungen des Übersetzers beschreibt und die famose Leistung von Ulrich Sonnenberg erklärt (ohne dabei die inzwischen vergriffene Ausgabe Roman einer Verwüstung, von 1992 von Gisela Perlet übersetzt, bei »Volk und Welt« erschienen, herabzusetzen). Wie auch schon die >a href=»https://www.glanzundelend.de/Red22/J‑L/johannes_vilhelm_jensen_himmerlandsgeschichten.htm«>Himmerlandsgeschichten des dänischen Literaturnobelpreisträgers Johannes V. Jensen, die von Ulrich Sonnenberg gleichsam großartig übertragen wurden, ist auch hier der Anmerkungsapparat vorbildlich. Es wird zudem deutlich, dass Absturz auch ein Großstadtroman ist.
Nicht umsonst gibt es Vergleiche zum Ulysses oder Berlin Alexanderplatz. Zwar ist die Verortung von Absturz in die literarische Moderne richtig, aber dennoch bleibt es ein singulärer Roman. Mit Döblins Franz Biberkopf oder Stephen Dedalus hat dieser Ole Jastrau nicht viel im Sinn. Selbst aus der zeitlichen Entfernung von fast einem Jahrhundert wirkt der Roman frisch und in der Beschreibung eines auf Selbstreferentialität fixierten Kulturbetriebs wunderbar zeitgenössisch. Die Lektüre von Absturz ist sowohl Vergnügen wie auch Herausforderung. Eben große Literatur.