In der (medialen) Öffentlichkeit ist es Konsens: Die Hinterbliebenen des Angriffs auf die beiden Tankzüge in der Nähe von Kundus in der Nacht vom 3. auf den 4. September 2009 müssen entschädigt werden. Die Einhelligkeit verblüfft. Aber das Andocken an die Schadenersatzforderungen reaktiviert die gute, alte bundesrepublikanische Tugend wieder: Man löst unangenehme Fragen am besten mit Geld. Der Anwalt der Hinterbliebenen, Karim Popal, beharrt darauf, direkt mit der Bundesregierung in Verhandlungen zu treten; er vertraut der afghanischen Regierung nicht und befürchtet, das Geld versickert in der Korruption. Diese Befürchtung ist nachvollziehbar.
Gregor Keuschnig
Lethargokratie, Staatsverschuldungsbeschleuniger und Semisozialismus
Peter Sloterdijk und die deutsche Politik
Eine irgendwie öde Diskussion, die da seit einigen Monaten (insbesondere von der ZEIT, aber auch in der FAZ) am Köcheln gehalten wird. Kern der Auseinandersetzung ist Peter Sloterdijks Artikel »Die Revolution der gebenden Hand« (allerdings auch einige Kapitel aus dessen Buch »Du musst dein Leben ändern«). Axel Honneth glaubte daraufhin nun Sloterdijk angreifen zu müssen, in dem er ihn – grob verkürzend – in durchaus altlinker Manier als Neu-Rechten und/oder wirtschaftliberalen denunziert, der irgendwie blind für die Bedürfnisse von Hartz-IV-Empfängern ist. Es gab einiges Feuilleton-Geplänkel und sogar eine brillante, aber schwer verständliche Verteidigungsrede von Karl-Heinz Bohrer in der FAZ.
Aber Sloterdijk wäre nicht Sloterdijk wenn er nicht zu einer Art Befreiungsschlag ausgeholt hätte; abgedruckt in »Cicero« mit dem ambitionierten wie provokativen Titel »Aufbruch der Leistungsträger«.
Dexter Filkins: Der ewige Krieg
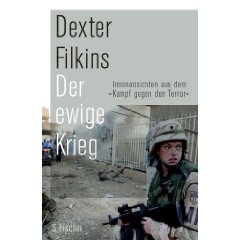
Dexter Filkins, 1961 geboren, kam zum ersten Mal als Korrespondent der Los Angeles Times im April 1998 nach Afghanistan und berichtete von dort regelmäßig bis zum Sommer 2000. Kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001, die er in New York erlebte, ging er nach Afghanistan zurück und blieb dort bis Ende 2002. Von März 2003 bis August 2006 lebte Filkins im Irak und berichtete von dort für die New York Times aus deren Bagdader Büro. »Der ewige Krieg«, ein in den USA vielfach prämiertes Buch, verspricht, so der Untertitel, »Innenansichten aus dem ‘Kampf gegen den Terror’ «.
Wieder einmal ein irreführender und effekthascherischer Untertitel. Er ist in doppelter Hinsicht irreführend. Zunächst existiert er im US-amerikanischen Original gar nicht – das Buch heißt dort einfach nur »The Forever War«. Zum anderen suggeriert man durch den Gebrauch der Vokabel »Kampf gegen den Terror« (der zudem noch eine falsche, verharmlosende Übertragung des »War on [against] terror[ism]« darstellt) eine mindestens teilweise introspektive Analyse über eine reine Schilderung des eigentlichen Krieges hinaus.
Avraham Burg: Hitler besiegen
Ein Buch wie eine Hilfeschrei. Hier schreibt einer, der getrieben ist von einer besseren Welt. Getrieben von dem Aufsprengen eines Teufelsreises mit den Mitteln der Einsicht, des Arguments – und der Empathie. Der Autor ist Avraham Burg, 1955 geboren, ehemaliger Offizier in einer Fallschirmjägereinheit, ehemaliger Vorsitzender der »Jewish Agency« und ehemaliger Knesset-Sprecher (ein vielfach »Ehemaliger« also). Burg ist Sohn eines »Jeckes«, eines Dresdner Universitätsprofessors, der in Deutschland blieb so lange es eben ging, für eine Unterorganisation des Mossad in Paris illegale Einwanderer herausschmuggelte und dafür sogar mit NS-Offizieren verhandelte und später Minister in mehreren israelischer Regierungen wurde und einer arabischen Jüdin, die als Kind nur mit Glück und Hilfe (ihres arabischen Vermieters) dem Hebron-Massaker 1929 entkam. Dieses Buch will er auch verstanden wissen als Gespräch mit seinem (verstorbenen) Vater und als Dialoggrundlage für seine Kinder (uns es gibt berührende Momente der Annäherung und der Bewunderung seinen Eltern gegenüber).
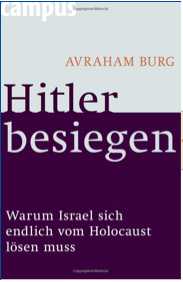
Lutz Seiler: Die Zeitwaage
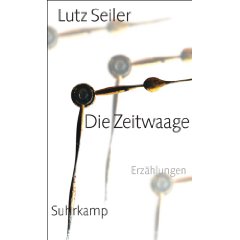
»Turksib« in ziemlicher Einmütigkeit den Ingeborg-Bachmann-Preis zugesprochen bekam. Auch wenn man vielleicht einen anderen »Lieblingstext« im Wettbewerb hatte – die Qualität dieser Prosa war eindeutig und tatsächlich herausragend. Und noch heute erinnert man sich an diesen schaurig-zärtliche Loreley-Gesang des russischen (?) Heizers auf den rüttelnden Turksib-Gängen. Vielleicht ist dieser Fischgesang, der sich zwischen Erzähler und Heizer für eine schwer durchatmete Dauer ereignete, der Kristallisationspunkt dieser Erzählung, die ansonsten fast nur aus der Bewältigung des Ich-Erzählers der Strecke vom Zugende zum Zuganfang (oder ist es umgekehrt?) und der Beschau eines Geigerzählers (und vor allem dem Geräusch!) zu bestehen scheint. Aber – und dies wird noch Gegenstand der Erörterung sein – es ist nicht immer ganz leicht, den Movens der Erzählungen von Lutz Seiler »herauszuarbeiten«, was allerdings die Lektüre zusätzlich reizvoll macht.
Der vorliegende Band mit dem schönen, allegorischen Titel »Die Zeitwaage« (eine Zeitwaage ist ein Instrument zur Feststellung der Ganggenauigkeit einer Uhr) umfasst dreizehn Erzählungen (die Titelgeschichte findet sich am Ende des Buches). Sie weisen formal kein einheitliches Schema auf. Häufig gibt es einen Ich-Erzähler, der bisweilen durchaus (biografische) Parallelen mit dem Autor suggeriert (aber manchmal wird dieses übereifrige Germanistensuchen auch auf perfide Art plötzlich, innerhalb der Erzählung, gebrochen) und sogar, einmal (in der Erzählung »Gavroche«), werden Erzähler und Erzählung selber Gegenstand der Erzählung. Und in einigen Geschichten gibt es abweichend einen auktorialen Erzähler.
Bis auf die ersten beiden Geschichten (»Frank« und »Im Geräusch«), die durch die Protagonisten miteinander verbunden sind (sie sind auf Urlaub in den USA), »Turksib« und die »Zeitwaage« (Berlin) kann man als Ort Seilers Heimat Thüringen ausmachen. Und obwohl die Geschichten in der ehemaligen DDR mindestens verwurzelt sind, die Protagonisten ihre Sozialisation dort erfahren haben (zu allerdings durchaus unterschiedlichen Zeiten) und es durchaus Anspielungen auf Skurrilitäten und Absonderlichkeiten des Systems gibt (diese meist eher mit leichter Hand gezeichnet), ist die »Zeitwaage« kein »DDR-Buch«, schon gar kein Bewältigungsbuch. Die Verstörungen und Verletzungen der Figuren sind auf eine fast betörende Art Zeugnis eines aus-der-Welt-gefallen-Seins und besitzen einen merkwürdig hohen Grad an Universalität (die allerdings in keinem Fall mit Beliebigkeit verwechselt werden darf).
Der pragmatische Versöhner
Wann immer in Deutschland in irgendeiner Form von der »Waffen-SS« die Rede ist, kann man sicher sein, dass die Empörungswellen, die Rituale der Entrüstung, hochschlagen. Noch heute brüsten sich Wohlstandskinder, die in den 60er Jahren aufgewachsen sind, mit wohlfeilen Enthüllungsgeschichten, die beweisen sollen, dass Prominente mit 15, 16 oder 17 Jahren in der »Waffen-SS« oder auch »nur« der »Partei« waren. Leute, die noch nie vor Situationen standen wie diese Grünschnäbel richten mehr als 60 Jahre nach Kriegsende mit einem Federstrich über das Leben dieser Leute.
Lange (oder immer noch?) galt diese Form des Journalismus als investigativ. Sie begann übrigens nicht erst mit 1968, wie uns heute die Veteranen dieser Zeit nahelegen wollen und damit hübsch weiter an ihrer eigenen »revolutionären« Legende stricken. Fest steht: Es gibt ungezählte Beispiele, wie Schriftsteller, Schauspieler, Journalisten, Politiker und andere Personen im öffentlichen Raum noch bis weit in die 1980er Jahre von ihrer Vergangenheit »eingeholt« wurden. Der linke Entlarvungsgestus in Sachen Nationalsozialismus entband von der Auseinandersetzung mit dem eigenen Irrweg, der zwar auch schon lange zurücklag, aber entweder heroisiert oder einfach nur verdrängt wurde. Engagement für Kuba? Maos Kulturrevolution? War da mal was?
Mit der Wende 1989/90 und der »Aufarbeitung« der DDR und ihrer Organisationen begann die zweite Welle. Diesmal nur aus der anderen Richtung. Während linke sogenannte Intellektuelle die DDR noch als »kommode Diktatur« einstuften (sie zogen es vor, in ihren Sommerhäusern in der Toskana oder Portugal Urlaub zu machen) wurde in typisch deutscher Gründlichkeit (Akten, die vernichtet wurden, werden inzwischen mit aufwendiger Technik wieder restauriert; das schafft auf Jahre Arbeitsplätze) beispielsweise das System der Staatssicherheit der DDR (versehen mit dem Kosenamen »Stasi«) akribisch untersucht.
(Nicolas) Mahler: Längen und Kürzen

Auf dem Umschlag steht nur »Mahler«. Der Titel: »Längen und Kürzen«. Man staunt, einen »Band I« eines »schriftstellerischen Gesamtwerks« in den Händen zu halten. Die Figuren hat man aber schon einmal irgendwo gesehen.
Mahler? Ja. Klar. Es handelt sich um den österreichischen Zeichner Nicolas Mahler (bekannt aus für FAZ, NZZ und »Titanic«, zum Beispiel).
Und ganz schnell geht man Mahler auf den Leim: Ist nicht der vor dem Verlagschef stehende und später in seinen Briefen mit »M.« zeichnende Dichter Mahler selber? Ein findiger Trick, denn man glaubt zunächst genau das Buch zu lesen, welches der Dichter seinem Verleger vorstellt (wie lakonisch diese gezeichneten Comics) und seiner Freundin Dorothee anpreist.
Der Balken im Auge der Journalisten
Eigentlich wollte Petra Gerster in der »heute«-Sendung vom 05.11.09 zeigen, wie »dramatisch« die Einbrüche bei den Steuereinnahmen sind. Da jedoch bei Kategorien von 500 Milliarden Euro und mehr die Relationen schwer vermittelbar sind, schritt man zur hyperdeutlichen Graphik, in der die Balken nur ab 500 Milliarden gezeigt wurden:

