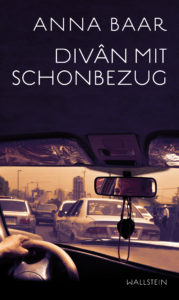
Knapp ein Jahr nach ihrem spielerisch-expressionistischen Roman »Nil«, der insbesondere in den deutschen Feuilletons vermutlich aufgrund seiner Komplexität eher gemieden wurde, legt Anna Baar mit »Divân mit Schonbezug« nun (vordergründig) einen Erzählband vor. Dass das Inhaltsverzeichnis am Ende des Buches steht, ist kein Lapsus. Denn tatsächlich sind die 30 Erzählungen (mit sehr unterschiedlichen Längen – von einer bis dreizehn Seiten) miteinander verwoben und selbst die scheinbar abseitigen, meist kurzen, anekdotisch gehaltenen Splitter fügen sich in den Korpus ein.
Dabei ist erstaunlich, mit welcher Brillanz Anna Baar zwischen Empörung und Furor über die politischen Verhältnisse (vor allem in Kärnten und im Detail an der »Landrandhauptstadt K.«) und Familiengeschichten, Kindheitserinnerungen und Reiseerlebnissen pendelt und zu einem eindrucksvollen Erzählkunstwerk verknüpft.
Immer wieder wird zwischen Persönlichem und Öffentlichem changiert. Da wird eine rhetorische Glut entfacht, die bei der Geschichte Kärntens und dem Verhalten der Deutsch-Österreicher den Kärtner Slowenen gegenüber in ein veritables Feuer übergeht. »Endlich waren die Bösen benannt«, so rekapituliert die Erzählerin: »Es waren die Kärntner Slowenen, und, schlimmer noch: Jugoslawen, denn die waren drauf aus, sich Kärnten anzueignen. Die Guten aber waren die Männer vom Heimatdienst, Landesverteidigungsmeister in stattlichen Uniformen, die man auf den Fotos ausgiebig bewundern konnte.« Und sie erinnert sich als Kind auf dem Stiftsgymnasium zusammen mit vier anderen nicht aufgezeigt zu haben, als es darum ging, sich zur Zweisprachigkeit zu bekennen.
Die Flammen dieses rhetorischen Feuers schlagen kaskadenhaft bei der Gegenwart in die Höhe, eine Gegenwart, die sich auf die Vergangenheit bezieht, ein Kontinuum bildet, ein unheilvolles. Wer kennt ihn nicht, den ehemaligen Landeshauptmann, der mit 142 km/h tödlich verunglückte aber immerhin eine Gasse im Zentrum von Klagenfurt erhalten hat, genau wie jener Arzt, der während des Nationalsozialismus Menschen kastrierte. Während man Gerd Jonke und Christine Lavant als Straßenpaten an die Ränder schiebt. Denn »Straßen sind geduldig. Sie können nichts für die Namen, die sie ungeachtet der redlichen Einwohner tragen.«
Es wechselt zwischen Aufruhr und Resignation. Mit »Die Wahrheit bleibt unzumutbar« wird die berühmte Ingeborg Bachmann kontrastiert, um wenig später das Unzumutbare auszusprechen. Die Erzählerin, der man aufgrund von einigen Indizien eine große Nähe zur Autorin attestieren darf, kam irgendwann aus einem inzwischen nicht mehr existierenden Land mit einigen anderen Familienmitgliedern nach Österreich, nach Kärnten. Im Geburtsland wie im neuen Land die ähnliche Erfahrung: Die Herkunft wird bestimmend, gar entscheidend. Sie tarnt sich mit »Heldengeschichten«, »war die ruhmreiche Tochter meiner römischen Mutter«. Wunsch eines anderes Anderssein als das ihrer Herkunft. Schließlich schloss sie sich denen an, »die ebenso fremd waren« wie sie selber, »jedenfalls ähnlich befremdet.« In diesem Kosmos »gab es nur englische Lieder«.
