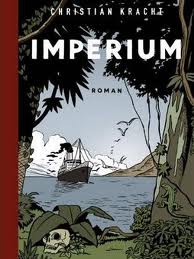Am Donnerstag beginnen die Bachmannpreislesungen – zwischen Fußball-EM und Olympischen Spielen. Nicht, dass die Veranstaltungen irgendwie zu vergleichen wären, aber ich möchte dann doch für jede mediale Verwendung der Floskel »Wettlesen« – des blödsinnigsten Begriffes, den es für diese Veranstaltung gibt – nur 10 Cent bekommen. Danach könnte ich wohl ein oppulentes Abendessen mit Freunden abhalten.
Man ist ja geneigt, jede Präsenz in den Medien zu einer solchen Veranstaltung (besonders im Vorfeld) zu begrüßen. Aber da man sich leider ein bisschen auskennt, ist die Freude eher gering. Da wird am 1. Juli in einer Literaturgruppe auf Facebook launig gefragt, wer denn den Preis gewinnen »soll«. Die Antworten sind naturgemäß eher fragend. Auf den Hinweis, man kenne die Texte nicht, werden die Links zu den Videoportraits der Lesenden gesetzt. Als würde dies alleine schon etwas über die Qualität der Texte aussagen. Einen Hinweis darauf kontert man patzig, die Regularien würden nun nicht unseretwegen geändert – und nun beginnt man, diese Regularien zu zitieren. Dabei hätte man bei vorheriger Lektüre gemerkt, wie dumm diese Frage nach dem »verdienten« Preis ist, es sei denn, man fällt ein Urteil aufgrund der (zumeist nichtssagenden) Portraitfilmchen. (Nur als Hinweis: Die Beitragstexte sind für die Öffentlichkeit bis zum Zeitpunkt der Lesung nicht zugänglich.) Wobei die Verwunderung über diese Form des Umgangs mit Literatur auch nicht mehr so ganz neuartig ist. Ignoranz als Prinzip. Oder: Wer ist denn heute noch so kleinlich und urteilt aufgrund eines vorliegenden Textes?