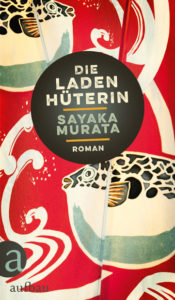
Die Ladenhüterin
Über den Roman »Die Ladenhüterin« von Sayaka Murata
Mit einiger Verspätung – aber wenn es um Literatur geht, ist es bekanntlich nie zu spät – habe ich Die Ladenhüterin von Sayaka Murata gelesen. Das Buch ist in Japan 2016 erschienen, Ursula Gräfes deutsche Übersetzung 2018; ich habe den kleinen Roman in der 5. Auflage der Taschenbuchausgabe von 2021 gelesen. Der zeitliche Abstand zur Erstpublikation und den Reaktionen darauf gibt dem Verlag die Möglichkeit, über den Erfolg zu jubeln und damit Werbung zu treiben (was ihm durchaus nicht zu verdenken ist): »Beeindruckend leicht und elegant«, das Buch habe die deutschen Leserinnen und Leser »im Sturm erobert« – obwohl es gar nicht stürmisch, sondern so sympathisch zurückhaltend wie die Ich-Erzählerin und Hauptfigur ist. Aber sei’s drum, wenn Literatur die Menschen erobert, soll’s mir recht sein.
Der Titel des Originals ist übrigens, wörtlich übersetzt, »Konbini-Menschen«, wobei im Japanischen ohne Kontext zunächst nicht zu entscheiden ist, ob Singular oder Plural, es könnten auch Konbini-Menschen sein, ein ganzer Menschenschlag, zu dem ich mich dann auch zählen würde, weil ich wie fast alle in Japan Lebenden häufig eines der zahllosen Konbinis – convenience stores – aufsuche. Ursula Gräfe hat den Titel nicht kongenial, sondern ingeniös übersetzt: Die Ladenhüterin, und sie hat das Wort sogar ein- oder zweimal in seiner zweiten Bedeutung in den Text eingestreut: Die Verkäuferin im Konbini ist eine unverheiratete Mitt-Dreißigerin, die anscheinend niemand heiraten will und die selbst auch nie auf die Idee gekommen ist, sich dem anderen Geschlecht sexuell anzunähern. Die Ich-Erzählerin, Keiko Furukura, bemüht sich nach Kräften, normal zu sein, das heißt so wie alle anderen zu sein, aber sie schafft es nicht, schafft es allenfalls am Rand der Normalität als unverheirateter freeter, der schlecht bezahlte Teilzeitarbeit verrichtet und in einer winzigen Wohnung haust. Zieht man dazu auch die kurz rekapitulierte Vorgeschichte dieser Frau in Betracht, Außenseiterin seit der Grundschule, fällt die Nähe zu einer anderen Symbolfigur der heutigen japanischen Gesellschaft auf, dem hikikomori, der sich in seinem Zimmer verbarrikadiert und zur Welt kaum noch Beziehungen unterhält.1
Die österreichisch-tschechisch-japanische Autorin Milena Michiko Flašar hat dieses Thema in ihrem Roman Ich nannte ihn Krawatte aufgegriffen. ↩


