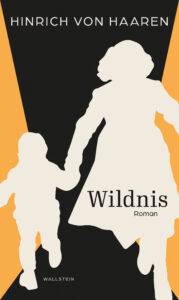
Wildnis
Zunächst ist man verwirrt. Ein gewisser Schult erwacht im Krankenhaus aus dem Koma und ist zornig. Er will niemand gebeten haben, ihn ins Royal London Hospital in Whitechapel einzuliefern und phantasiert, er sei bis gerade zum zweiten Mal tot gewesen, das erste Mal 1943, als Sechsjähriger, in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli, in Hamburg, Stadtteil Hammerbrook, am Grünen Deich. Wer ein wenig Geschichtskenntnisse hat, weiß, was in dieser Nacht in Hamburg geschah. Es wird später als der Hamburger Feuersturm bezeichnet werden. Gottfried Schult und seine Mutter überleben; der Vater war bereits 1941 in Russland gefallen.
Der 61jährige, in London lebende, deutsche Autor Hinrich von Haaren bleibt in seinem Roman Wildnis bei diesem Gottfried Schult, nennt ihn stets nur »Schult«, was bewusst eine Distanz erzeugt. Die Mutter wollte, dass Schult nach der Schule eine Banklehre macht, aber der schrieb sich zum Studium für Geschichte ein. Es war nachträgliche Opposition zu seinem Nazi-Lehrer auf der Schule, der das »Dritte Reich« schlicht übergangen hatte. Schult wollte es genauer wissen. Nach dem Studium bewarb er sich auf eine Dozentenstelle in England, wurde zu seiner eigenen Überraschung angenommen und aus Gottfried wurde Geoff. Zwanzig Jahre nach dem Feuersturm war er also nun in Cambridge, wenn es auch nur das nicht so berühmte »Downing College« war.
Der akademische Betrieb erzeugte bei Schult ein Phlegma; er fand sich früh damit ab, keine Karriere machen zu können. Zu Beginn lernte er die Nonkonformisten Tom und Liz kennen, die selber kaum Ambitionen hegen. Eine der wenigen Freundschaften, die Schult einging, denn er war kontaktscheu. Um dem Uni-Betrieb zu entfliehen, mietete er sich eine kleine Wohnung am Arnold Circus, einem der ältesten Stadtviertel Londons; damals, 1964 beim Einzug, anziehend schäbig. Hier konnte er seine Homosexualität abseits von Cambridge ausleben, besuchte ab und zu das »George and Dragon«, eine eher vergammelte Kneipe mit einer herzlichen Wirtin. Und hier fand er die Stricher, die er bezahlte und dabei froh war, keine weiteren Verpflichtungen zu haben. Die hypochondrische Mutter in Hamburg wird zwei Mal im Jahr besucht; man hatte sich wenig zu sagen. Den Weihnachtsbesuch brach Schult immer am 23.12. ab. Nur einmal, während eines Kuraufenthalts, lebte das Verhältnis der beiden für kurze Zeit auf.
Was Schult nie ganz loslässt, ist der Krieg. Liz und Tom winken ab und an der Uni will man nichts von möglichen britischen Kriegsverbrechen hören. Darum geht es aber Schult gar nicht; der empfindet die Bombardierungen als Reaktion auf Goebbels’ Sportpalast-Rede. Immer häufiger taucht er in die Zeit ab. Mutter und Sohn hausten nach dem Feuersturm einige Monate in einer Art Kellerloch. Schult wurde als jüngstes Mitglied in eine »Trümmerbande« aufgenommen, die durch die Ruinen zog. Besonders hatte es ihm der damals zwölfjährige Anführer Karl Hinze angetan, den er nie mehr vergessen wird. Hinze war Spezialist darin, die umherstreunenden und von den Leichnamen fett gewordenen Ratten umzubringen. Anfangs hörte man noch »sprechende Trümmer«, die nach einigen Tagen verstummten. Schult kannte schnell die unterschiedlichen Flugzeugtypen, die ihre Bomben abwarfen und hegte keinen Groll gegen die englischen Piloten. Seine Mutter kam abends mit Lebensmitteln und damals begann ihr Reinlichkeits- und Putztick. Merkwürdig, dass er diese Zeit als eine seiner glücklichsten Momente in Erinnerung hat. Im November 1943 zog man nach Eilbeck; die Trümmerbande war Vergangenheit, man begegnete sich nie mehr.
Die Zeitsprünge zwischen Schults Gegenwart und Kindheit nehmen zu. Nach außen lethargisch, steigt im Inneren von Schult eine seltsame Kraft an, die sich wie auf einer Umlaufbahn einem imaginären Ziel nähert. Seine Alltags-Betulichkeit scheint wie die Ruhe vor dem Sturm. Dieser wird ungeplant mit seinem 60. Geburtstag entfacht. Im »George and Dragon« gibt es dazu eine Feier und Schult bechert reichlich. Er ist nicht mehr in der Lage, ohne Hilfe nach Hause zu kommen. Nur noch die Wirtin und ein gewisser Ely sind da. Ely begleitet ihn, bringt ihn ins Bett. Und nun beginnt zum ersten Mal in Schults Leben eine Liebesgeschichte. Dabei ist Ely 34 Jahre jünger. Schult lebt auf. Er fasst Mut zu einem Buch, zu seiner Geschichte im Hamburger Feuersturm, aber als Wissenschaftler reiht er nur Zahlen und Fakten aneinander, weiß bald alles über Art und Menge der Bomben über Hamburg, die vermuteten Opferzahlen, inklusive der abgeschossenen Piloten (das waren nicht wenige!). Er besucht die Orte in London, die von deutschen Bombern zerstört wurden, besonders die Kirchen, kann sie am Ende wie eine Litanei herunterbeten. Später wird er einen gewissen Clive Shell ausfindig machen, einen Piloten, ihn besuchen, aber der will nicht reden, zeigt ihm seinen Garten, der irgendeinen Preis bekommen hat. Schult kommt nicht erzählerisch voran.
Ely, der junge Liebhaber, leidet unter dem Jähzorn Schults, seiner Zerrissenheit, dem Wechsel zwischen Apathie, »Vergangenheitskrise« und den immer intensiver werdenden Flashbacks von jener schrecklichen Nacht. Schult braucht Ely, der sich um ihn kümmert, manchmal das Apartment aufräumt, wenn Schult es in einem Wutanfall verwüstet und seine Notizen in Müllsäcke stopft, als Inspiration und Motor. Gleichzeitig hat er Angst, das er, der wesentlich Ältere, verlassen wird. Schult lernt eine kroatische Ärztin kennen, die Parallelen zwischen ihm und sich zieht. Beide seien sie Flüchtlinge »vor den Toten«, sagt sie. Schult lehnt dieses Bild ab. An der Uni wird ihm ein Überflieger vorgesetzt, der sich ausgerechnet um die Bombardements der Briten im Zweiten Weltkrieg wissenschaftlich kümmern will, das »Zeitalter jenseits der Vergeltung« ausruft und plötzlich findet sich Schults Büro in einem ehemaligen Kopierraum. Das Ende einer Karriere, dies es nie gab.
All diese Ereignisse beschleunigen seine Rückblicke, die sich ruckartig in Bilderströmen filmischen Ausmaßes ergießen und Verschollenes zum Vorschein bringen. Plötzlich imaginiert er eine Hand, die er hält, als er mit der Mutter den sicheren Tod vor Augen, den Luftschutzkeller verlässt, ins Freie tritt, vor den Flammen flieht, in den heißen Ruinen herumstolpert, die verkohlenden, nach vorne umgekippten Menschen schaudernd betrachtend. Noch spürt er die Hand und dann, irgendwann, lässt er sie los, nur eine Sekunde oder den Bruchteil davon und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf und der Roman erreicht seinen Höhepunkt. Es ist die Hand von Toni und dann erinnert er sich an Frau Knecht aus dem Luftschutzkeller, die einmal meinte, dieser Keller sei doch nur den »Gesunden« vorbehalten, und »nicht solchen wie sie«. Und Schult fällt wieder zurück in die Zeit, in der er, der Sechsjährige, sich einst um die Neunjährige kümmerte, mit ihr nach Finkenwerder übersetzte und dort die glücklichste Zeit seines Lebens verbrachte.
Er hat ein Gefühl, als hätte der bisherige Gedächtnisverlust sein Überleben gesichert. Schult droht, den Boden unter den Füssen zu verlieren. Wie groß ist seine Schuld (!) gegenüber Toni? Nur langsam öffnet er sich mit diesen Fragen seinen wenigen Freunden und sie alle sagen das gleiche: er soll seine Mutter besuchen, mit ihr reden, aber Schult vertraut diesem Reden nicht, er ruft sie an, außer der Reihe, bringt keinen Ton hervor, auch sie schweigt und es heißt lakonisch »Seine Mutter hat ihn erkannt an seinem Schweigen«. Und dann besucht er sie doch.
Der Titel Wildnis erschließt sich aus einem Gedicht von Emily Dickinson, welches der Autor seinem hybriden Roman vorangestellt hat. Hinrich von Haaren kompiliert die Intention von W. G. Sebalds Luftkrieg-Essay von 1999 mit expressiven Darstellungen eines Feuersturms, die an Gert Ledigs Vergeltung erinnern, ohne diesen zu kopieren. Zusätzlich verstärkt werden die Eindrücke mit Original-Zitaten aus Samuel Pepys Tagebucheintragungen über den Großen Brand von London im September 1666.
Die allmähliche Entbergung von Schults Erinnerungen, seine diesbezüglichen Qualen, lassen ihn sogar mehr als 50 Jahren plötzlich Stigmata an einer Hand wuchern, »Geschwülste von alten, unbehandelten Brandwunden«, heißt es. Eine Operation hilft nicht, der Erinnerungsjunkie lebt irgendwann fast nur noch von Schmerztabletten, die ihm die kroatische Ärztin besorgt. Schults in eine Katastrophe mündende Obsession zieht den Leser in den Bann, weil erzählt und nicht erklärt wird. Und am Ende glaubt man zu wissen, was dieses Foto, dass ihn seit mehr als fünf Jahrzehnten als einzigen Gegenstand aus seiner Kindheit überall hin begleitet, zeigt. Wildnis ist ein ergreifendes Buch.
