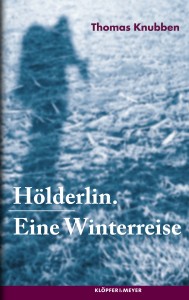
Hölderlin. Eine Winterreise
Am 6. oder 7. Dezember 1801 bricht der Hauslehrer und Schriftsteller Johann Friedrich Christian Hölderlin von Nürtingen nach Bordeaux auf. Es war eine Reise ins Ungewisse, von Herzens- und die Nahrungsnot getrieben. In Bordeaux sollte er eine Stelle im Hause des Weinhändlers und Hamburgischen Konsuls Daniel Christoph Meyer antreten und die Kindererziehung übernehmen. Etwas mehr als zweihundert Jahre später bricht der Germanist und Kulturwissenschaftler Thomas Knubben ebenfalls von Nürtingen nach Bordeaux auf. Gründe nennt Knubben nicht, außer, dass er seit einem Vierteljahrhundert diese Reise im Sinn hat. Soll es eine Annäherung werden? Immerhin: Knubben setzt – wie er selber ausführt – eine lange Winterreisetradition fort: man denke an Seume, Heinrich Heine, Goethe, Büchners Lenz, Franz Schubert und – in jüngster Zeit – Werner Herzog (»Vom Gehen im Eis« wird einmal sogar fast ehrfürchtig erwähnt). Und wie ist das, jemandem trotz der zeitlichen Distanz so dicht »auf den Fersen« zu sein?
Knubben skizziert die Ausgangslage Hölderlins und dessen fehlgeschlagene Vorhaben: Das Scheitern seines Zeitschriftenprojekts (selbst Schiller sagte eine Mitarbeit ab; der Text ist abgedruckt). Die bei Kollegen freundliche, aber insgesamt eher zurückhaltende Aufnahme des »Hyperion«-Briefromans. Der missglückte Versuch, einen Lehrauftrag an der Universität Jena zu erhalten. Viele seiner Hauslehreranstellungen wurden schnell wieder aufgelöst; die Gründe sind unklar. Und von der Liebe seines Lebens, Susette Gontard, der Diotima seiner Gedichte, war er auch getrennt. Wollte Hölderlin seinen Wirkungskreis erweitern und nahm deshalb Abschied von seiner so geliebten Heimat? Und wie erklärt sich die überstürzte Rückkehr?
Fragen über Fragen. Früh bemerkt der Leser: Knubben ist kein Hölderlin-Verklärer. Dafür weiss er zuviel, was im Laufe des Buches unangestrengt und ohne apodiktische Untertöne ausgebreitet wird. Fast beiläufig räumt Knubben mit einigen Legenden über Hölderlin auf. Tatsächlich war der Dichter keineswegs mittellos, wie dies immer kolportiert wird. Das väterliche Vermögen wurde lediglich von seiner Mutter mit schwäbischer Sparsamkeit verwaltet, vom Sohn jedoch partiell durchaus einkalkuliert. So findet sich ein Zitat über die Vorbereitung einer Fußreise in die Schweiz 1791, aus dem hervorgeht, dass Hölderlin einen Wanderführer für das Tragen seines Gepäcks anstellen wollte. Nach seinem Tod vererbte er ein stattliches Vermögen an seine Geschwister. Auch das Bild des zarten, schwachen Dichters entspricht nicht der Wahrheit. Hölderlin war mit 1,80 m für damalige Verhältnisse ein Hüne und auch sonst ein ganzer Kerl mit gehörigem Temperament und bis zum Lebensende niemals angekränkelt. Tagesmärsche von 30, 40 Kilometern waren für ihn kein Problem.
Das Buch ist sehr gut lesbar, aber beileibe nicht trivial (nur ab und an fällt eine saloppe Formulierung; es gibt einen gravierenden Fehler, als aus Caspar David Friedrich »Conrad« wird) und mit seinen 24 Kapiteln (à rd. 10 Seiten) fast perfekt gegliedert. Auf der Rückseite des Buchumschlags ist eine Karte von 1806 abgedruckt, auf der ein (möglicher) Reiseweg nebst Orten eingezeichnet ist. Passend zur jeweiligen Situation gibt es Textausschnitte vor allem von Hölderlin und Zeitgenossen, aber auch Harald Schmidts Diktum von 2002, Hölderlin sei ein »Typ für die Masse«, der Werke geschrieben habe »die man auch mal locker am Strand zwischendurch lesen« könne, bringt er unter und kommentiert trocken: Ich habe es versucht, an den Gestaden des Mittelmeeres, es geht vorzüglich.
Immer wenn sich die Spuren Hölderlins besonders gut nachverfolgen lassen, also bis Straßburg, vor Bordeaux und in Bordeaux selber, dominieren sie in Knubbens Bericht. Auf Seite 89 wandert Knubben in Straßburg ein, wo Hölderlin am 15.12.1801 eintraf und infolge von Passformalitäten erst am 30.12. weiterreisen konnte. Bis dahin ist er wie ein Detektiv auf den Spuren des Dichters, fächert behutsam Hölderlins Lebenslauf auf und berichtet auch Spekulatives. Natürlich weiß er, was nicht sein kann, weil etwa ein Bauwerk 1801 noch gar nicht errichtet war. Ein bisschen überraschend die Erklärung, dass Hölderlin die weitere Strecke bis Bordeaux unmöglich zu Fuß bewältigt haben kann. Warum Hölderlin über Lyon und nicht Paris gewandert ist, vermag auch Knubben nicht zu klären. Die 550 km von Straßburg bis Lyon in knapp zehn Tagen (er ist dort am 9. Januar 1802 eingetroffen) traut er selbst dem wandererprobten Hölderlin nicht zu (nur einmal gelang Knubben nach einigem Verirren eine Tagesstrecke von 53 km). Klug wird aus Indizien abgeleitet, dass Hölderlin ab Straßburg bis kurz vor Bordeaux die Strecke mit Schnellkutschen zurückgelegt haben muss. Warum Knubben selbst den Fußweg wählt, wird nicht ganz klar; seine »Verstöße« (Busfahrten beispielsweise) sind nur äußerst marginal.
Im Buch findet nun ein Perspektivwechsel statt: Hölderlins Reise im 19. Jahrhundert tritt zu Gunsten von Knubbens Erlebnissen des 21. Jahrhunderts in der französischen Provinz in den Hintergrund. Man ist verwundert, wie schwierig es sich auf der Strecke über Belfort, Besançon und Dôle nach Lyon zuweilen gestaltete, ein Quartier nebst Restaurant zu finden. Häufig sind die kleinen Ortschaften, die er passiert, wie ausgestorben und Knubben muss unverhofft bis in den Abend hinein über unmarkierte Waldwege weitergehen. Man erlebt ihn freudig, dann wieder verzagt, mit kaputten Füßen, desorientiert (die Wegbeschriftungen sind katastrophal, wenn überhaupt vorhanden), selten schwärmerisch. Das Weihnachtsfest in Montbéliard (die ehemalige württembergische Exklave Mömpelgard) nebst Christmette ist von ziemlicher Trostlosigkeit. Manchmal ist es sogar gefährlich, besonders wenn die Franzosen auf die Jagd gehen, Knubben im Wald unterwegs ist und Schüsse und umherhetzende Hunde näherkommen. Zu selten hat er ein Auge für das Schöne und nur ab und zu kreuzt er eine Ortschaft, in der Hölderlin gerastet haben könnte. Etwas entspannter wird die Reise wenn es einmal nicht regnet, schneit oder friert – und wenn der Gehweg mit dem Jakobsweg übereinstimmt (dann sind die Wegzeichen da und eindeutig). Ansonsten vertreibt sich Knubben die Einsamkeit durch das Schreiben von Postkarten. Kurz hinter Lyon wird er noch krank und schleppt sich fiebrig durch die Landschaft. Immerhin verbessert sich jetzt die Quartierlage. Aber weiterhin wird jede Begegnung mit Menschen zu einem Ereignis; schnell kommt er in Kontakt und ins Erzählen. Und am Ende gelingt so etwas wie eine melancholische Kulturgeschichte der französischen Provinz. Die letzten Kilometer bis zum Ziel dürfte auch Hölderlin wieder zu Fuß bewältigt haben. Er trifft am 28.02.1802 in Bourdeaux ein. Und mit Knubben ist der Leser auf Seite 187 in Bordeaux.
Hier sind natürlich wieder Spuren von Hölderlin aufzunehmen und manchmal glaubt man, Knubben befrage einmal kurz das Gemäuer eines Hauses, um eine Frage zu beantworten. Sofort wechselt der Pol des Erzählens wieder auf die Ereignisse um den Dichter. Der Leser taucht in die Nachrichtenwelt des 19. Jahrhunderts ein und überzeugend wird ausgeführt, dass und wie Hölderlin von der Krankheit von Susette Gontard erfahren haben könnte. Hierin sieht Knubben den Grund für die überstürzt anmutende Rückreise. Hölderlin hatte am 10. Mai 1802 seinen Pass in Bordeaux erhalten und verlässt Straßburg in Richtung Kehl schon am 7. Juni. Wo er sich unmittelbar danach aufgehalten hat, ist nicht klar; es gibt unterschiedliche Versionen. Am 22. Juni stirbt Gontard in Frankfurt. Es gibt erst wieder Aufzeichnungen von Anfang Juli 1801, in denen über eine leichte Besserung des verstörten und verwahrlosten Zustands Hölderlins berichtet wird. Aber noch 1803 ist Schelling, ein Stubengenosse aus Studentenzeiten, erschüttert vom psychischen Verfall Hölderlins. Die Bordeaux-Reise wird, so Knubben, zu einem der tiefsten Einschnitte in Hölderlins Leben. Sie gliederte sein Dasein in ein Davor und ein Danach. Aber ist es wirklich diese Reise gewesen – oder nicht doch Susettes Tod?
Knubbens Buch eignet sich sehr gut als Einstieg für eine weitere Beschäftigung mit Leben und Werk Friedrich Hölderlins. Es liegt in der Natur der Sache, dass vieles nur angedeutet werden kann. Dabei werden auch negative Aspekte angesprochen, wie die nationalistisch anmutende Vaterlandseuphorie des Dichters, die entsprechend von den Nazis vereinnahmt wurde. So ist die einzig detaillierte Interpretation eines Hölderlin-Textes im Buch diejenige des martialisch klingenden Gedichtes »Der Tod fürs Vaterland«. Knubben liest es als Gesang für die revolutionären Kriege Frankreichs gegen die alte Fürstenherrschaft, als Kampf gegen die gedungenen Söldnerheere. Dabei ist »Vaterland« nicht das Land der Väter, der Herkunft und des Herkommens, sondern ‘la patrie’, das Land der Verheißung, für das Helden und Dichter aus alter Zeit stehen. In Wahrheit zeige sich hier Hölderlins Sympathie für die Werte der Französischen Revolution.
Knubbens Buch ist stark, wenn er sich Hölderlin und seiner Zeit zuwendet. Hier wird er leidenschaftlich und besticht mit seinen Kenntnissen. Seine Wandererlebnisse geraten dabei etwas in den Hintergrund; sie werden allzu nüchtern erzählt. Dabei fehlt Knubben die epische Innigkeit eines Werner Herzog, der er glücklicherweise gar nicht erst versucht nachzueifern. Beide Erzählstränge des Buches kommen leider nur selten zusammen, wie beispielsweise das Erlebnis, als er in Meximieux, einer Partnerstadt von Denkendorf, der Stadt, in der Hölderlin zur Klosterschule ging, am Straßenrand einen Mann anspricht, der Hölderlin und seinen »Hyperion« kennt, nachdem Knubben zu Beginn von einem Wirt aus Denkendorf erzählte, dem der berühmte Sohn vollkommen unbekannt war.
Das Buch endet mit einem wunderbaren Gedicht von Thomas Brasch. Am Ende schlägt man es dankbar zu. Und ist um einiges klüger geworden.
Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.

Diese Dichter-Weitmärsche sind ein apartes Kapitel der Kulturgeschichte.
Zum Wandern auf Hölderlins Spuren gibt es eine feine Anekdote aus dem Leben eines anderen Weitwanderers: Robert Walser. Einmal geht es mit Carl Seelig von der Anstalt Herisau aus nach Hauptwil. Hier war Hölderlin ab Anfang 1801 Hauslehrer bei der Familie Gonzenbach. Auch diesen Schweizer Arbeitsplatz hatte Hölderlin zu Fuß erreicht, wurde aber im April 1801, kaum drei Monate später, schon wieder gekündigt und konnte nach Tübingen zurückwandern. da war er fit für die Tour nach Bordeaux.
Walser und Seelig also wandern 1944 nach Hauptwil, was ca. 15 km einfache Wegstrecke sind, für einen einfachen Sonntagsspaziergang: ordentlich. Sie kehren – wie immer bei solchen Unternehmungen – ein, »vorzüglicher Kaffee und rezenter Tilsiter«, notiert Seelig. Anschließend fragt er: Wollen wir uns jetzt noch die Hölderlin-Gedenktafel hier im Ort ansehen? Und Walser antwortet, wie man walserisch nur antworten kann:
»Nein, nein, um solches Plakatgeschrei kümmern wir uns lieber nicht! Wie widerwärtig sind doch die Dinge, die sich demonstrativ pietätvoll gebärden! Übrigens war ja Hölderlin nur eines der vielen Menschenschicksale, die sich hier abgespielt haben. Man darf über einer Berühmtheit nicht das Unberühmte vergessen.«
(nachzulesen in Carl Seelig: Wanderungen mit Robert Walser. Bibliothek Suhrkamp, 1977, S. 70)
Und dann lungern sie halt noch ein bisschen am Ort herum, und wandern irgendwann wieder zurück. Zur verschmähten »Hier-war-Hölderlin-Hauslehrer«-Gedenktafel pilgerte dafür später noch Heidegger. Der fuhr aber mit dem Auto, was ja schon nicht mehr die ganz reine Lehre ist, aber halt 21. Jahrhundert: Auch ein Wolfgang Büscher umrundete die Republik in »Deutschland, eine Reise« soweit ich mich erinnere, nicht nur zu Fuß.
»Plakatgeschrei«. Schön.
–
Und es gibt auch eine Reise von Roger Willemsen, quer und ziellos durch Deutschland, mit der Bahn (»Deutschlandreise«). Ich habe das Buch nicht ganz gelesen, aber es schien mir arg misanthropisch. Vielleicht eine Form von Misanthropismus die bei Zufussgehenden nicht aufkommt und beim abgekapselten Autofahrer schnell wieder verfliegt.
(Und da fällt mir noch eine winterliche Reise ein, aber die war auch nicht zu Fuß.)
Warum ist die Rezension eines Buches über die Reise Hölderlins, einem der großen Meister der Lyrik in deutscher Sprache, mit einem Zitat aus Rilkes Duineser elegien überschrieben?
Absicht, Fehler, Provokation, ...............................???
@Werner König
Sie meinen die Überschrift bei Glanz & Elend? Ehrlich gesagt: Ich weiss es nicht. Die Überschrift ist nicht von mir.
Aber was ist daran schlimm?
Nichts ist daran »schlimm« – eher verwunderlich.