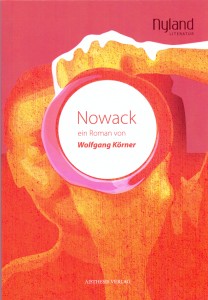Leif Randt zählt längst zu jener kleinen Gruppe der Schriftsteller-Generation Y, die irgendwann in konzertierter Aktion von Kritik und Literaturwissenschaft zu Feuilletongünstlingen avancierten. Randt entwickelte sich vom Popliteraten nicht zum Midcult-Autor, sondern konstruierte in seinen Romanen »gemischte Wirklichkeiten«, bestehend aus »medialem (Selbst-) Entwurf und sinnlicher Existenz im Hier und Jetzt« (Baßler/Druegh). Dunkel habe ich noch den leicht dystopischen Sound von Schimmernder Dunst über Coby County in Erinnerung. Über die dann folgenden Bücher hatte ich so viel gelesen, dass ich mir die Lektüre ersparte. Nun liegt mit Let’s talk about emotions Randts neuer Roman vor und ich wollte unbedingt die Folge des Nichtlesens durchbrechen.
Erzählt wird etwas mehr als ein Jahr im Leben des Boutiquenbesitzers Marian Flanders, 41, Sohn der berühmten Caroline Flanders, eines Models, die vor allem in den 1970er und 80er Jahren Kultstatus genossen hatte. Es beginnt mit der Seebestattung von Caroline, deren Asche (leicht vorschriftswidrig) vom Schiff von Marians Vater, dem bekannten Nachrichtenanchorman der 2000er Jahre Milo Coen, der nun fast 80 Jahre alt ist, auf den Wannsee verstreut wird. Mit dabei auch Milos Kinder aus seiner zweiten Ehe, Teda, 27, eine weltweit bekannte EDM-DJ und Colin, Familienvater von Zwillingen.
Zu Beginn macht man sich noch die Mühe, die Protagonisten zu dechiffrieren. Ist Marians Mutter etwa Veruschka von Lehndorff? Oder deren Mutter Eleonore »Nona« von Haeften? Und der Nachrichtenmann: Könnte Ulrich Wickert gemeint sein? Als man dann erfährt, dass der Roman am 2. Juni 2025 beginnt und die Bundeskanzlerin Fatima Brinkmann von »Progress ‘16« heißt (Vizekanzler ist Robert Habeck von »Bündnis 90«), die Libertären die gefährlichste Partei darstellen (Marian hatte die Linkspartei gewählt) und von der zweiten Amtszeit von Bernie Sanders hört, stellt man das Suchen ein. Randt erschafft sich seinen Wunschkosmos, der für das weitere Verständnis des Buches keine Rolle spielt.