Porträt des musischen Informatikers Peter Reichl
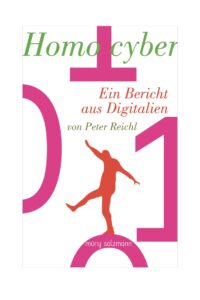
Homo cyber, der kybernetische Mensch. Nicht zu verwechseln mit dem Cyborg, der maschinelle Prothesen in seinen Körper integriert hat. Freilich tendiert auch der kybernetische Mensch dazu, sich digitale Geräte einzuverleiben. Beobachtet man Passagiere in der U‑Bahn, gewinnt man den Eindruck, dass sie ihr intelligentes »Telefon« gar nicht mehr loslassen, als könnten sie ohne es nicht existieren.
Homo viator, homo ludens… Es gab in der Vergangenheit noch andere feste Wortverbindungen mit »homo«. Homo faber – der Macher, Handwerker, Techniker – tritt im gleichnamigen Roman von Max Frisch als Inbegriff des Ingenieurs auf. Peter Reichl, der die neue Wortverbindung geprägt hat und als Buchtitel verwendet, kommt in den beiden bisher erschienen Bänden1 mehrfach auf Max Frisch und seinen Ingenieur zu sprechen. Anscheinend haben der Kybernetiker, der Informatiker, der Programmierer, aber auch der gemeine »User« von Personalcomputer und Smartphone, den Ingenieur als Leitfigur der Moderne abgelöst. Der Homo sapiens hat sich zum Homo cyber gewandelt.
In der biographischen Notiz am Ende von Reichls Buch erfahren wir zu unserer Überraschung, dass der Autor Informatikprofessor an der Universität Wien ist. Gut, der Mann hat vielerlei mitzuteilen, und manches davon geht nicht so leicht in einen mathematisch ungebildeten Kopf, obwohl da von sehr alten, verhältnismäßig einfachen Problemstellungen die Rede war. Gleichzeitig aber waren in dem Buch Haltungen ausgedrückt, Schlussfolgerungen formuliert und Vorschläge gemacht, zu denen ich selbst auf anderen Wegen gelangt war, etwa in dem Buch Parasiten des 21. Jahrhunderts. Als digitaler Skeptiker – wie der Informatikprofessor selbst? – beschloss ich, mehr darüber herauszufinden, wollte aber alles Googeln vermeiden.
Reichls Büro befindet sich in einem zweistöckigen containerartigen Annex der Wiener Fakultät für Informatik. Das Gebäude muss demnächst wieder abgerissen werden, an seiner Stelle wird dann, wer weiß für wie lange, wieder eine Baulücke sein. Was an Reichls körperlichen Erscheinung zunächst auffällt, ist der graue, fast weiße Rauschebart, dazu kleine, springlebendige Augen hinter der eckigen Brille. Eine gewisse Fülligkeit ist nicht zu verleugnen – man könnte den Mann mit der kräftigen Stimme für einen Opernsänger halten, und tatsächlich wäre er in jungen Jahren fast ein solcher geworden. Auf den Arbeitstischen stehen kleine, altertümliche Rechenmaschinen, wie ich sie von Ablichtungen in den beiden Büchern kenne. Reichl liebt es, auf die Frühgeschichte der Informatik hinzuweisen, deren Beginn man etwa 1623 ansetzen kann. In diesem Jahr erfand der deutsche Gelehrte Wilhelm Schickard eine Rechenmaschine, mit der man vielstellige Zahlen addieren, subtrahieren und multiplizieren konnte.
