»Der Eindruck, die etablierte Politik sei unfähig oder unwillig, die Probleme der Zeit zu lösen, ist eine Ursache für den Erfolg populistischer Parteien«, so schreibt Robin Alexander in seinem neuen Buch Letzte Chance auf Seite 338. Wer bis dahin gelesen hat, wundert sich. Denn dass die »etablierte Politik« – gemeint sind vor allem die Protagonisten der »Ampel«, aber auch die der letzten vier Jahre der Merkel-Regierung – größtenteils unfähig respektive unwillig zu konstruktiver Politik waren, ist nicht nur ein »Eindruck«, sondern es ist (bzw. war) handfeste Realität, wie auf nahezu allen der bis dahin zurückliegenden 337 Seiten in zum Teil ermüdend zu lesender Akribie ausgeführt wurde.
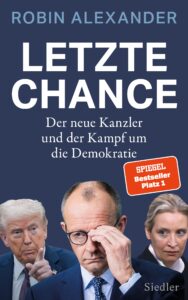
Überall stehen administrative, formale wie informelle Regularien und Regeln, die aus diversen Erwägungen heraus nicht angetastet werden (können), sachgerechten Lösungen im Wege. Das politische System nähert sich mit all seinen Ausdifferenzierungen, Ausnahmeregelungen, gegenseitigen Rücksichtnahmen bedingt durch persönliche Befindlichkeiten von sich wichtig nehmenden politischen Akteuren wie Fraktions- oder Parteivorsitzenden, Ministern, Staatssekretären, Parteiflügelvertretern und Lobbyvertretern der Dysfunktionalität. Wenn dann noch das gegenseitige, koalitionsbedingte Observieren nach dem Motto »Wer-macht-den-nächsten-Fehler?« auf den Plan tritt, wird vielleicht noch verwaltet, aber nicht mehr zukunftsfähig regiert.
Das Scheitern der sogenannten Ampel-Regierung war vorauszusehen. Die weltanschaulichen Differenzen der Parteien standen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Anfang an im Wege. So hätte man dem politischen Konkurrenten seine Erfolge gönnen müssen, statt sich in krämerischem Kleinklein zu verbeißen, wie in einem wahrlich schillernden Beispiel gegen Ende der Ampel herausgearbeitet wird. Die Grünen wollten den Steuergrundfreibetrag um 312 Euro/Jahr anheben. Die FDP nun kam auf die Idee, »da die Inflation etwas höher ausfiel als prognostiziert […] den Betrag nun auf 324 Euro [zu] erhöhen.« Diesen Minimaltriumph gönnten die Grünen der FDP nicht. Und so »blockiert das FDP-Finanzministerium das Vorhaben des SPD-Arbeitsministeriums, um Druck auszuüben auf die ihrerseits blockierenden Ministerien der Grünen. Und das alles für 12 Euro Unterschied im Jahr, die man nicht versteuern muss. Regierungschaos wegen einem Euro pro Monat.« Aber Alexander schießt über das Ziel hinaus, wenn er als Gegenbeispiel Merkel anführt, die einst Dobrindt mit seiner »Ausländer-Maut«-Geschichte auflaufen ließ. »Dass diese Straßengebühr für nichtdeutsche Autofahrer am Ende vor europäischen Gerichten scheitern würde, war Merkel immer klar. Den Milliardenschaden für Steuerzahler nahm sie in Kauf. Der Koalitionsfrieden mit der CSU war ihr wichtiger.« Milliarden verschwendete Steuergelder um des lieben Friedens willen? Das kann doch nicht ernst gemeint sein, ein solches Verhalten als Blaupause für Koalitionsfrieden zu empfehlen.
In gewohnter Alexander-Manier werden mit buchhalterischer Präzision sehr viele der absurden Wendungen der Ampel herausgearbeitet. Und man mag danach verstehen (nicht zu verwechseln mit: rechtfertigen), warum einfache Lösungen immer mehr zu Sehnsuchtsobjekten des Wählers werden. Letzte Chance zeigt überdeutlich, dass rasche und nachhaltige Lösungen inzwischen faktisch unmöglich geworden sind. Und gezeigt, nein: vorgeführt wird, wie abgekoppelt der politische Betrieb inklusive Beobachter von den sich disruptiv verändernden Realitäten ist.
Zu besonderer Hochform läuft der Autor auf, wenn er die zum Teil gymnastischen Übungen der Politiker der »Mitte« schildert, um sogenannte Zufallsmehrheiten mit der AfD zu vermeiden. Wenn es dann einige Male auf Länderebene nicht wie gewünscht klappt (Gebührenerhöhung öffentlich-rechtlicher Rundfunk Sachsen-Anhalt; Grunderwerbssteuer Thüringen), verfällt man in das bekannte Muster des Skandalons. Formale Aspekte stehen wie gehabt immer über den Inhalt und werden zu demokratietechnischen Grundsatzfragen hochgejazzt.
Dass auf dieser Basis natürlich Friedrich Merz’ Vorgehen im Januar zum sogenannten Fünf-Punkte-Plan und, wenige Tage später, dem »Zustrombegrenzungsgesetz«, in dem er bewusst die Zustimmung der AfD nicht nur in Kauf genommen, sondern ihnen Entscheidungsgewalt zugestanden wurde, ist natürlich der größtmögliche Sündenfall für jemandem, der über 70 Mal im Buch das Wort von der »Mitte« verwendet, freilich ohne auch nur einmal eine halbwegs konzise Definition hierfür abzugeben. Sicher, man ahnt, was damit gemeint ist – insbesondere wenn dann ein paar Mal fast pathetisch von der »demokratischen Mitte« die Rede ist. Aber man möchte schon fragen, ob die Juso-SPD und die Audretsch-Grünen tatsächlich ernsthaft als politische Mitte gelten.
Daher ist es ziemlich merkwürdig, dass der bekennende Ukraine-Unterstützer Robin Alexander bei seinem Ausführungen zur fatalen Gasabhängigkeit von Russland, in die man sich seit Schröder wider besseres Wissen begeben hat, die kriminell zu nennenden Vorkommnisse rund um die »Stiftung Klima- und Umweltschutz MV« und den Genossen Manuela Schwesig und Erwin Sellering mit keinem einzigen Wort erwähnt (auch ein CDUler war übrigens dabei). Alexander folgt hier stramm der Linie der öffentlich-rechtlichen Medien, die diesen Skandal mit ohrenbetäubendem Schweigen behandeln, angeblich, wie mir ein Journalist einmal schrieb, aus Rücksicht vor der schweren Krankheit von Schwesig aus dem Jahr 2019 (ich will das nicht glauben).
Den Verkauf etlicher Gasspeicher an Gazprom nennt Alexander immerhin noch naiv, nach 2014 spricht er von »Landesverrat«. Folgen für die Verantwortlichen sind übrigens auch hier nicht bekannt; vielleicht hat man der Einfachheit halber auch gar keine Verantwortlichen gesucht. Auch über die dauernden Störmanöver der »Zeitenwende«-Politik durch Leute wie Ralf Stegner verliert Alexander kein Wort, sondern inszeniert stattdessen Rolf Mützenich als eine Mischung aus Fraktions-Pate und jovialem Friedensonkel, der intellektuell und geopolitisch im Jahr 1983 stehengeblieben ist. Wie kann man ernsthaft eine SPD, in der solche Leute wichtige Funktionen einnehmen, als »Mitte« einordnen?
Das schlechte Wahlergebnis der Union führt Alexander auf Merz’ Schwenk im Wahlkampf zurück, die Migrationsproblematik nach dem Aschaffenburg-Anschlag Ende Januar 2025 ins Zentrum zu rücken. Bei Allensbach hätte man ihm nach den sehr guten Werten Anfang des Jahres geraten, einen Wirtschaftswahlkampf zu führen. Nach Aschaffenburg habe Merz den Schwerpunkt nicht zuletzt aus emotionalen Gründen verändert und von da an sei die Zustimmung bei den Wählern deutlich unter das angestrebte Minimalziel von 30% gesunken. Aber handelt es sich wirklich um eine Kausalität oder ist es nur eine Korrelation? Die Frage muss am Ende unbeantwortbar bleiben. Zumal das wirtschaftspolitische Konzept der Union – finanziert hauptsächlich mittels imaginärem Wachstum – selbst wohlmeinenden Interpreten als ziemlich suspekt erschienen war. Die Skandalisierung von Merz’ Kurswechsel im Wahlkampf hat allerdings der AfD nicht geschadet. Weil man der Union nicht glaubte? Immerhin: Die orchestrierten Übergriffe auf CDU-Parteizentralen durch von staatlicher Beihilfe finanzierter NGOs bewertet Alexander als »Breite der Protestbewegung«. Erstaunlich, wie der Mob hier nobilitiert wird.
Vieles erinnert in diesem Buch an den Ausführungen in den Machtwechsel-Podcasts, die Alexander mit Dagmar Rosenfeld fast wöchentlich produziert. Hörer wie Leser werden sukzessive zum Geschäftsordnungsprofi. Man lernt, was ein Entschließungsantrag ist, bekommt die Bedeutung eines »Spiegelkabinetts« erklärt, erfährt warum ein »Überschreitungsbeschluss« nichts mit dem »Sondervermögen« zu tun hat, erkennt den Unterschied zwischen »EKF« und »KTF«, wird in die Nuancen in die relevanten Details von »EEG«, »BEG« und »GEG« eingeführt und erfährt fast nebenbei, wieviel Geld eigentlich in diversen Schattenhaushalten angelegt ist (es ist sehr viel!). Man bekommt vor Augen geführt, warum ein Streichen umweltschädlicher Subventionen anscheinend unmöglich ist und lernt noch, dass Hauptstadtjournalisten den Gebrauch von Richtlinienkompetenz und Vertrauensfrage des Kanzlers als Ausweise von Schwäche sehen.
Nahezu jede Nuance der diversen Sitzungen zwischen Scholz, Habeck und Lindner und deren Abgesandten werden aufgearbeitet; sogar, wenn nachts um vier Uhr morgens irgendwo Hamburger gekauft werden, weil man nach hunderten Sitzungsstunden schlichtweg immer noch uneins war. Überall lauern Fallen, organisatorischer, administrativer und nicht zuletzt medialer Art; das sprichwörtliche Feilschen auf einem orientalischen Markt ist seriös zu nennen im Vergleich zu diesem Geschacher. Nur eines gerät den Politikern und auch den Medienbeobachtern nach und nach dabei aus dem Blick: Die Lösung der mehr oder weniger dringenden Probleme des Landes.
Alexanders Aufarbeitungen sind zu loben. Aber einiges erstaunt. Etwa der Befund, die FDP habe sich in der Ampel »nach rechts entwickelt«. Hatte man nicht brav all den Unsinn à la Selbstbestimmungsgesetz mitgetragen? Interessant ist die Aussage, dass der deutsche Verwaltungsapparat unter anderem während der Corona-Pandemie effektiv gearbeitet habe. Wird da nicht Effektivität mit Effizienz verwechselt? Die Empörung zum Graichen-Nepotismus hält Alexander insgesamt für überzogen. Habeck kommt von den drei Ampel-Chefs insgesamt noch am besten weg, Lindner wird zwischen den Zeilen mindestens zwei Mal der Lüge bezichtigt. Fast nebenbei erfährt der Leser, dass das Scholz’ Statement zum Bruch der Koalition keineswegs spontan war. Daher konnte es auch vom Teleprompter abgelesen werden, weil es zwei Tage zuvor schon verfasst war. Also auch Scholz log. Und vermutlich nicht nur einmal. Erstaunlich, dass die murkshafte Wahlrechtsreform nicht behandelt wird.
Manches ist schlicht falsch. Die Wehrpflicht wurde nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Im Kosovo hatte man keine bosnischen Muslime beschützen wollen, sondern albanisch sprechende Kosovaren. Dass die Ampel-Regierung die »Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas« nicht zu verantworten hatte, stimmt nur zum Teil: die SPD war hier federführend (siehe oben); die Verträge zu Nord Stream 1 wurden noch von Schröders rot-grüner Regierung unterzeichnet.
Der Titel Letzte Chance ist die Summe der umfassenden Berichterstattung über das Vergangene als eine Beschwörung einer ungewissen Zukunft. Die neue Regierung aus SPD und Union sei, so der Tenor, zum Erfolg verurteilt, ansonsten drohten rechts- wie linkspopulistische Parteien an der nächsten Regierung beteiligt zu werden. Alexander lässt es sich nicht nehmen, der neuen Regierung als Lehren aus dem Desaster der Ampel Ratschläge zu geben: »Wer eine breite politische Mitte und damit das über Jahrzehnte erprobte Erfolgsmodell der Bundesrepublik Deutschland erhalten will, muss spürbare Veränderungen erreichen. Die neue Bundesregierung muss für mehr wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sorgen, für eine Grundsicherung, die nicht wie das Bürgergeld als ungerecht empfunden wird, für eine Migration, die das Land nicht überfordert, und für einen Klimaschutz, der funktioniert und sozial ausgewogen ist.«
Was Alexander übersieht: Gerade die gebetsmühlenhafte Beschwörung der (ungenau definierten) »Mitte« stärkt paradoxerweise die Ränder, weil die weltanschaulichen Differenzen innerhalb der Mitte-Parteien für die in Koalitionen notwendigen Kompromisse verschwimmen. Nicht umsonst ist das Adjektiv, dass dem Kompromiss im alltäglichen Sprachgebrauch anhaftet, pejorativ. Es lautet »faul«. Wähler der Randparteien nehmen Kompromisse gar nicht als solche wahr, sondern sehen sie als Produkte einer in sich geschlossenen, monolithischen Machtelite, die aus untereinander austauschbaren Parteien besteht.
Im deutschen Verhältniswahlrecht sind nun Koalitionen unvermeidbar. Alexander weist darauf hin, dass Zersplitterungen des Parteiensystems (jüngstes Beispiel: BSW) dazu beitragen, dass Lösungen unter konkurrierenden Parteien auszuhandeln, immer komplizierter zu wird, weil jede Partei zuerst ihre Klientel zufrieden stellen muss. Volksparteien mit mehreren Flügeln werden hingegen rasch als zerstritten wahrgenommen. Die Union kann ein Lied davon singen. Und die SPD wurde in den letzten Jahrzehnten mehrere Male auseinanderdividiert.
Ein Blick auf den Bundesrat und die dortigen Mehrheitsverhältnisse sei erlaubt: Es gilt dort, Mehrheiten unter inzwischen acht Parteien zu finden. Diese Gemengelage muss bereits bei der Formulierung von in der Ländervertretung zustimmungspflichtigen Gesetzen »eingepreist« werden – andernfalls scheitert das Gesetz. Die Liste, wann sich bei Einbringung eines Bundesgesetztes zur Abstimmung im Bundesrat ein Bundesland aus Koalitionsräson enthalten muss, wird immer unübersichtlicher und ermöglicht oft gar keine Einigungsmöglichkeiten im früher sehr wichtigen und produktiven Vermittlungsausschuss.
Es besteht kein Zweifel daran, dass die AfD von der neurechten Szene gesteuert wird. Dennoch steht sie zeitweise bundesweit bei 25%, in einigen ostdeutschen Ländern droht sie bei den nächsten Wahler die (strategische) Mehrheit zu erreichen und damit Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten zu erheben. Die von Medien und nicht zuletzt von der politischen »Mitte« praktizierte Dämonisierung, die sich bis hinein in Protokollkinkerlitzchen erstreckt, ist gescheitert. (Nein, ich möchte nicht, das AfD-Leute im Parlamentarischen Kontrollgremium sitzen, aber es macht mir nichts aus, wenn es einen Bundestags-Vize aus der Partei geben würde.)
Die von der »Mitte« im Habitus der Herablassung und Arroganz vorgetragenen Besserwissereien, sei es bei Migration, innere Sicherheit oder »Zeitenwende«, ihre Übergriffigkeiten während der Pandemie, haben sich als kontraproduktiv erwiesen. Statt zu erklären und langfristige politische Strategien zu entwickeln, werden Andersdenkende oder auch nur Fragende pauschal zu Demokratiefeinden oder, in erschreckender Verharmlosung den historischen Gegebenheiten gegenüber, zu »Nazis« erklärt. Dies ruft nicht nur weitere Trotzreaktionen hervor, sondern verhindert längst konkrete parlamentarische Arbeit, etwa wenn es darum geht, Untersuchungsausschüsse zu beantragen, weil man befürchtet, auch die AfD könnte zustimmen. Auf diese Weise regiert die AfD längst indirekt mit. (Ähnliche Berührungsängste gegenüber der Linken hat man nicht; die Partei steht, so scheint es, unmittelbar vor Eingemeindung in die »Mitte«.)
Die letzte Hoffnung ist jetzt ein AfD-Verbotsverfahren. Basis hierfür soll wohl der Verfassungsschutzbericht sein, der, wenn die Leaks stimmen, im Wesentlichen aus öffentlichen Zitaten von AfD-Protagonisten oder Interpretationen von Gerichtsurteilen zu einzelnen Verfahren bestehen. Die Frage, wohin nach einem erfolgreichen Verbot die Wähler gehen werden, scheint niemand zu interessieren. Jeder würde sie, die einst Denunzierten, natürlich gerne nehmen, aber dass sie in Scharen »die Mitte« wählen werden, ist ausgeschlossen. Immerhin hätte man für eine kurze Zeit einen politischen Konkurrenten aus dem Weg geräumt und vielleicht für eine Legislatur die Macht gesichert. Wahrscheinlich wird sich einfach eine neue Partei gründen – mehr oder weniger mit den gleichen Darstellern und Programmpunkten. Der größte anzunehmende Unfall wäre allerdings das Scheitern eines solchen Verbotsverfahrens. Dem vorzugreifen, droht eine noch massivere Intervention der Politik bei der Besetzung neuer Richterpositionen im Bundesverfassungsgericht. Philip Manow hat analysiert, wohin solche Maßnahmen womöglich führen können.
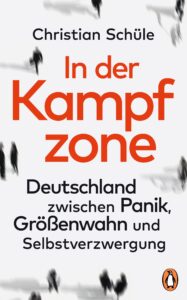
Ein anderes Buch kommt mir in den Sinn, erschienen bereits 2019, vor der Pandemie. Geschrieben wurde es von dem Publizisten Christian Schüle. Es trägt den leicht martialischen Titel In der Kampfzone und ist genau so gemeint. »Die Kampfzone«, so Schüle, »ist bestimmt von einem horizontalen Kampf (links gegen rechts), einem vertikalen Kampf (unten gegen oben) und einem metaphysischen Kampf (liberal gegen ideologisch).« Und weiter: »Das Betriebssystem dieser Kampfzone ist die Erregokratie: eine nervlich überspannte, nervöse, manchmal hyperventilierende, von Medien aller Art stimulierte Dauererregung, die zum geradezu totalen Spektakel einer Emotionalisierung um ihrer selbst willen geführt hat.«
Man möchte ohne Unterlass aus diesem sechs Jahre alten Buch zitieren, weil es einen immer noch gültigen Befund über die politische und auch gesellschaftliche Zerrissenheit der Bundesrepublik liefert. Es ist eine Zerrissenheit, die auch nicht vor der Person des Autors Halt macht und ihn immer wieder übermannt. Programmatisch heißt es: »Ich wende mich im Folgenden auf manchmal schamlos zugespitzte, manchmal arglos übertriebene, immer aber unbestechliche Weise gegen Hyper- und Doppelmoral, Hysterie und Hybris, Panik und Panikmache und die Widersprüche eines reaktionären Widerstands von allen Seiten auf allen Seiten.« Und er konstatiert: »Von den meisten nicht bemerkt, schlug irgendwann bei mehr Mitbürgern als vermutet Wut in Hass um. Beides lässt sich als Resultat erlittener Ohnmacht und gekränkter Selbstwirksamkeit interpretieren, und entscheidend ist […] dass der Vorrang des Logos, die politisch verhandelte Vernunft, durch den Thymos, die vitalisierende wie auch zerstörerische Lebenskraft, infrage gestellt wird (und womöglich schon ist).«
Es ist ein bisschen unfair, ein in weiten Teilen beschreibendes Buch wie das von Robin Alexander einem analytischen Essay gegenüber zu stellen. Es geht mir darum festzustellen, dass Appelle oder gar Verbote die »Kampfzone« der politischen Willensbildung nicht befrieden werden. Hierfür bedarf es konkreter politischer Maßnahmen. Und eines Journalismus, der sich jenseits der Erregungsmodi bewegt und weniger Meinungen oder Haltung verbreitet, sondern sachbezogen berichtet und das Urteilen dem Publikum überlässt.
