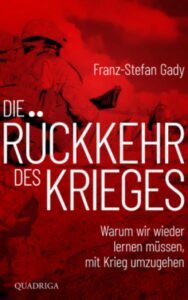
Spätestens seit dem 24. Februar 2022, dem Beginn des Überfall Russlands auf die Ukraine, ist der Krieg, ob man will oder nicht, wieder unmittelbar in Europa präsent. Vergessen die vielen Stellvertreter- und Regionalkriege, die seit Jahrzehnten und auch nach dem vermeintlichen »Ende der Geschichte« auf der Welt tob(t)en. Die sogenannte Friedensdividende ist aufgebraucht. Rückwirkend betrachtet begann das alles schon viel früher. Man wollte jedoch unter anderem aus ökonomischen Gründen die Zeichen der Zeit nicht erkennen und verfiel in einen geopolitischen Dornröschenschlaf. Und immer noch ist vielen der Weckruf derart unangenehm, dass sie darauf bestehen, weiter schlafen zu dürfen. Es sind jene, die mit ihren außenpolitischen Einschätzungen seit je stets falsch gelegen haben.
Zeit also für ein aufklärendes, versachlichendes Werk über das, was wir Krieg nennen. Der österreichisch-amerikanische Militäranalyst Franz-Stefan Gady hat dies mit Die Rückkehr des Krieges versucht. Seine These geht dahin, dass Kriege in Mitteleuropa und damit auch im deutschsprachigen Raum wahrscheinlicher geworden sind. Zitiert wird unter anderem der amerikanische Historiker und Diplomat Philip Zelikow, der die Wahrscheinlichkeit auf 20 bis 30 Prozent für einen weltweiten Krieg »in den kommenden Jahren« angibt. Der militärische Hegemon USA, der bisher als Garant europäischer Sicherheit galt, wird, könnte durch einen drohenden Konflikt mit China um Taiwan im Indopazifik beansprucht werden während gleichzeitig Russland in gezielten kleinen (oder großen) Operationen NATO-Gebiet im Baltikum angreift. Europa muss also im eigenen Interesse militärische Abhängigkeiten von den USA minimieren und auf konventionellem Gebiet abschrecken können.
Gady beschäftigt sich zunächst mit dem »Zeitalter der Fehleinschätzungen«, das irgendwann in den 1990er Jahren begann. Sukzessive verabschiedeten sich die (West-)Europäer beispielsweise von der Möglichkeit im Verteidigungsfall eine »hoch intensive Landkriegsführung« führen zu können. Mit dem Fokus auf neue Technologien vernachlässigte man als veraltet betrachtete Militärtechniken und die Produktion ausreichender Munition. Die Verteidigungshaushalte wurden zusammengestrichen. Man konzentrierte sich auf die Planung regional und zeitlich begrenzter Auslandseinsätze. Eine militärische Abschreckung schien unnötig zu sein. Der sich bereits in der Nachrüstungsdebatte Mitte der 1980er Jahre abzeichnende Pazifismus feierte mit dem Fall der Mauer in einem »postheroischen Weltbild als identitätsstiftendes Ideal« seinen Durchbruch.
Im Rahmen dieses Pazifismus-Denkens werden Kriege häufig als tragische Ereignisse dargestellt, die sich wie Naturkatastrophen unaufhaltsam zusammenballen und dann entladen. Gady widerspricht zu Recht dieser Schicksalsgläubigkeit entschieden. Kriege sind »bewußte, politische Entscheidungen« von Menschen mit ihren von »Hybris getriebenen Emotionen« nebst ökonomischen und imperialen Interessen. Kein Krieg ist unvermeidbar. Kriege sind kalkuliert, auch wenn sich diese Kalkulationen fast immer als falsch herausstellen. Die einzige autonom getroffene Entscheidung in einem Krieg ist der Beginn. Danach tritt unweigerlich das Chaos ein, das Unberechenbare, der Zufall, der »Nebel des Krieges«, Damit greift Gady die »Schlafwandler«-These von Christopher Clerk an, die den Ausbruch des Ersten Weltkriegs als eine Art Taumel der Großmächte-Herrscher darstellt, der irgendwie unbeabsichtigt zum Krieg geführt habe. In Wirklichkeit waren es eine Kette von Fehleinschätzungen. Die russische Invasion von 2022 ist das aktuellste Beispiel für eine solche Fehleinschätzung: Die Russen adaptierten den US-amerikanischen Einsatz von 2003 im Irak und glaubten, rasch in Kiew einmarschieren und die Regierung übernehmen zu können. Dabei unterschätzten sie sowohl den Widerstandswillen und die Kampfkraft der Ukrainer und setzten zu wenige Raketen ein, um die militärische Infrastruktur der Ukraine zu zerstören.
Gerade weil Krieg das »schlimmste Übel« ist, muss man alles dafür tun, ihn zu verhindern. Was jetzt geschehen muss, sieht Gady denn auch nicht als Aufrüstung, sondern »Nachrüstung«. Es geht um Verteidigungsfähigkeit, nicht darum, Angriffspotential zu entwickeln. Die Streitkräfte insbesondere in Deutschland müssen wieder auf einen Stand gebracht werden, der es ermöglicht, russischen Bedrohungsszenarien glaubhaft zu begegnen. Dieses Abschreckungsprinzip muss wieder reaktiviert werden. Gleichzeitig, und daran lässt Gady auch keinen Zweifel, müssen immer diplomatische Kanäle offen gehalten werden. Als Vorbild nennt er hier die »Doppelstrategie für Abschreckung und Entspannung«, die 1977 Helmut Schmidt in einer Grundsatzrede formuliert hatte.
Das zweite Kapitel beginnt mit einer Art Würdigung von Clausewitz’ Vom Kriege, um dann überzugehen in eine Mischung aus Transformation wesentlicher Elemente dieses Standardwerks in die Gegenwart und Vademecum der Probleme und Unbill der Kriegsführung im 21. Jahrhundert. Man erfährt einiges über die Wechselwirkung zwischen Kultur und Kriegsführung, bekommt den Unterschied zwischen Plan, Strategie und Doktrin erklärt und warum Doktrinen sich nur sehr schwer ändern. Kriegsführung ist nicht nur durch geographische Lagen geprägt, sondern auch von Struktur und Design der jeweiligen Streitkräfte. Relevant sind technologische Aspekte und Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann. Gady warnt allerdings eindringlich vor »Wunderwaffen«, die einen Krieg alleine entscheiden sollen – das gäbe es nicht. Eine Taurus-Lieferung an die Ukraine beispielsweise würde den Krieg nicht entscheiden. Auch eine übermäßige Konzentration auf Cyberangriffe wie auch den Einsatz von KI-Systemen sieht Gady kritisch, wenn sie nicht eine Gesamtstrategie der einzelnen Waffengattungen eingebettet sind. Entscheidend ist immer der »Kampf der verbundenen Waffen«. Gerade hier liegt eine Schwäche der Ukraine-Bewaffnung, weil sie Waffensysteme unterschiedlicher Provenienz und Technik erhält.
Die einzelnen Kapitel liefern militärtheoretisches Rüstzeug. Man bekommt beispielsweise erklärt, worin der Unterschied zwischen einer Division und einer Brigade besteht und warum der Westen zwischenzeitlich einzelne Ebenen, wie etwa das Korps abgeschafft hat. Teilstreitkräfte, die je in ihren geografischen Räumen agieren, werden »Domänen« genannt. Zu den drei bekannten Domänen Heer, Luftwaffe und Marine werden noch Cyber- und Weltraumaktivitäten gezählt. Gady hatte zu Beginn klargestellt, dass er keine wissenschaftliche Arbeit oder Studie vorlegt, demzufolge sind die Erklärungen in populärwissenschaftlichem Ton verfasst; Anglizismen kann man allerdings nicht ausweichen. Den Begriff der Militärwissenschaften sieht Gady kritisch; das Chaos und die »Friktionen« des Krieges sind derart, dass wissenschaftliches Arbeiten eher schwierig ist. Er bevorzugt den Begriff der »Kriegskunst«. Immer wieder flechtet Gady seine Eindrücke aus Afghanistan und den zahlreichen Besuchen der Ukraine ein.
Es finden sich zahlreiche interessante Fakten. Etwa, wenn Gady das Kostenverhältnis zwischen (billigen) Drohnen, die in Schwärmen angreifen können und der (teuren) Raketenabwehrmunition erläutert. Oder im Kapitel über Militärlogistik vom »Zahn-zu-Schwanz-Verhältnis« die Rede ist. Gemeint ist das Verhältnis zwischen Kampftruppen an der Front und Truppen, die Unterstützungsdienste erbringen. In Streitkräften mit streng hierarchischer sowjetischer Militärkultur (heutiges Russland) liegt das Verhältnis bei 1:3 oder 1:4. Für jeden kämpfenden Soldaten werden drei oder vier Unterstützer (Logistik, Nachschub) benötigt. Westliche Truppen legen einen höheren Wert auf Logistik und haben im Allgemeinen ein höheres Verhältnis von 1:7 bis 1:10. An anderer Stelle berichtet Gady, dass in der Ukraine bisweilen sowjetische und westliche Militärkultur, die nicht nur auf Hierarchie setzt, sondern »von unten nach oben« denke, in einer Art Kulturkampf aufeinandertreffen und für Komplikationen sorgen. Dabei ist klar, dass auch im westlichen Modell ein gewisser Drill erforderlich ist; »flache Hierarchien« kann es in einer Armee nicht geben.
Gady erläutert, wie »Multi-Domänen-Operationen« in Planspielen aussehen müssten. Immer wieder betont er, wie Chaos und unkalkulierbare Zufälle solche Strategien unterlaufen werden und ständig neu angepasst werden müssen. Eine alleinige Fokussierung auf technologische Nach- bzw. Aufrüstung stößt bei ihm auf Skepsis. Beispielsweise werden in gewissen Konstellationen, so seine These, unbemannte Drohnen auch in zwanzig Jahren Flugzeuge nicht ersetzen können. Stattdessen sollte die »Integration von bemannten und unbemannten Systemen«, die »autonom oder halbautonom« agieren, angestrebt werden. Eine vermeintliche technologische Überlegenheit einer Streitmacht verleitet unter Umständen zu Vernachlässigungen anderer Truppenteile und trägt womöglich zu einem unangemessenen Überlegenheitsgefühl bei. Im Gegensatz zu vielen Kollegen (die er auch zitiert) glaubt Gady, dass sich Armeen evolutionär und nicht revolutionär entwickeln. Hierfür bringt er einige Beispiele an.
Es ist schade, dass das Buch vor den US-Präsidentschaftswahlen im letzten Herbst erschienen ist. Die Tabellen über Truppen- und Domänenstärken der US-Armee in Asien und Europa und die »mögliche Aufteilung« dieser Streitkräfte im Kriegsfall erscheinen unter einem eher sprunghaft agierenden Präsidenten Trump überholt. Zwar spricht Gady eine neue mögliche Präsidentschaft Trumps an, aber er beruhigt. Die Spaltung des politischen Amerika sieht er nicht zwischen Isolationisten und Interventionisten, »sondern zwischen Institutionalisten und Nicht-Institutionalisten«, kurz gesagt in der Frage: »Soll die amerikanische Militärmacht in Strukturen und Institutionen eingebettet bleiben, oder soll sie ungebundener, ungezügelter und damit auch willkürlicher oder unvorhersehbarer zum Einsatz kommen?«
Das Buch zeigt deutlich, dass die USA auch in einigen, wichtigen konventionellen Gefechtsfeldern lange Zeit unentbehrlich sein werden. Ein Beispiel ist die Bekämpfung von Flug- und Raketenabwehrsystemen auf feindlichem Territorium. Und wie sieht es mit der nuklearen Beistandsgarantie der USA aus? Gady stellt sie nicht infrage. Den atomaren Schutzschild von Großbritannien und Frankreich sieht er als »unglaubwürdig« an, was die Abschreckungswirkung angeht. Aber wie würde eine Beistandsgarantie der USA aussehen, wenn, wie im letzten Teil ausgeführt, Russland in schnellen »Fait accompli«-Operationen Teile des Baltikums (Vilnius beispielsweise) angreifen und besetzen würde und danach die Verteidigungs-Intervention der NATO mit nuklearer Erpressung (taktische Atombombe) versuchte, zu unterbinden?
Noch sieht Gady die russischen Streitkräfte nicht in der Lage, schnelle Operationen mit dauerhaften Raumgewinnen beispielsweise über den Suwałki-Korridor durchzuführen. Aber im Krieg mit der Ukraine hat sich gezeigt, dass Russland in der Lage ist, rasch auf neue Gegebenheiten zu reagieren. Zudem läuft die Rüstungsmaschine (vermutlich mit heimlicher chinesischer Unterstützung) auf Hochtouren. Man könnte auch daran denken, dass es eine Intervention ähnlich 2014 auf der Krim gäbe; Carlo Masala hatte ein solches Szenario entwickelt. Auf das Szenario in Future War, indem um 2030 herum ein konzertierter Angriffskrieg Russlands und Chinas die russische Annexion des Baltikum in nur dreizehn Tagen ermöglicht, geht Gady nicht ein.
Zwei Dinge bleiben unerörtert. Gady berichtet wiederholt von seinen Erkenntnissen bei Besuchen in der Ukraine und überrascht gegen Ende mit der fast beiläufig eingestreuten These: »Kein europäisches Land wäre derzeit in der Lage, einen Krieg, wie ihn die Ukraine in ihrem eigenen Land kämpft, zu führen.« Man hätte jetzt gerne erfahren, wie er den weiteren Fortgang des Krieges sieht. Was ist zu tun? Der europäische Westen beschränkt sich auf moralische Durchhalteparolen und ist inzwischen nahe der Irrelevanz. Wirtschaftlichen Sanktionen steht Gady kritisch gegenüber; seit je hätten solche Maßnahmen das Gegenteil dessen bewirkt, was intendiert war. Ohne Waffenlieferungen der USA wird sich die Ukraine dauerhaft nicht verteidigen können. Putin spielt auf Zeit; Verluste interessieren ihn nicht. Die nukleare Erpressung durch Russland zu Beginn des Krieges scheint zu wirken.
Zum anderen wird mehrmals im Buch die »kulturelle Zurückhaltung« Deutschlands betont. Gady spricht von einem »parasitären Pazifismus«, weil man zum einen die Bedrohungen nicht sehen wollte, zum anderen jedoch darauf baute, dass, sollte wider Erwarten doch etwas geschehen, die USA wie selbstverständlich bereitstünde. Deutschland betrieb Sicherheitspolitik in einer Kombination aus »Trittbrettfahren« und Scheckbuchdiplomatie. Es geht nun darum, die veränderte Lage anzuerkennen und Sonntagsreden in Praxis umzuwandeln. Die potentiellen Gefahren sind real.
Aber die Zurückhaltung ist nicht auf eine kleine Gruppe beschränkt. Es sind große Teile der Regierungspartei SPD und nahezu die gesamte organisierte Linke in Deutschland, die immer noch im Lummerland der 1970er Jahre leben. Dies trägt dazu bei, dass immer weniger Menschen bereit wären, das Land zu verteidigen. Das hat sowohl mit der historisch begründbaren Scham zu tun, sich mit Deutschland zu identifizieren als auch mit dem kaum noch vertrauenswürdigen, jammervollen politischen Personal, welches im V‑Fall solche Entscheidungen treffen müsste. Und die Bereitschaft, das dysfunktionale Beschaffungssystem der Bundeswehr anzugehen, scheint auch nicht besonders ausgeprägt zu sein.
Trotz der kleinen Einwände kann man Die Rückkehr des Krieges jedem an militärischen Details interessierten Leser empfehlen. Im Lektürenachweis und in den Endnoten finden sich weiterführende Bücher und Studien (viele davon in englischer Sprache).
