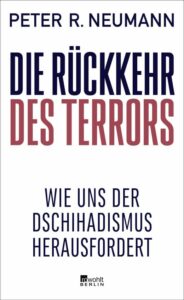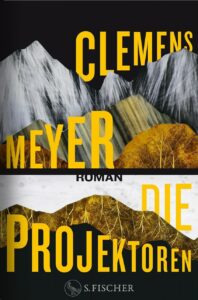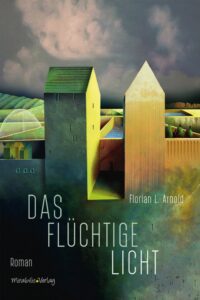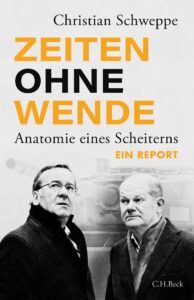
Fast zweieinhalb Jahre beobachtete der Journalist Christian Schweppe das, was man »Zeitenwende« nannte: Die Reaktionen der deutschen Regierung auf den Überfall Russlands auf die Ukraine. Schweppe weiß, dass es vom Kanzlerstuhl der Regierungsbank zum Rednerpult sieben Schritte sind. Am 27. Februar 2022 rief Bundeskanzler Olaf Scholz eine »Zeitenwende« aus. Später erfährt man von Schweppe, dass Scholz sich mit dem Begriff der Zeitenwende selbst plagiiert hatte; er verwendete ihn bereits 2017 in einem Buch, freilich ohne Verbindung mit militärischen Fragen. An jenem Februar 2022 kündigte er eine Instandsetzung der längst marode gewordenen Bundeswehr mittels einer als Sondervermögen deklarierten Verschuldung von 100 Milliarden Euro an und versprach, zukünftig 2% des BIP für die Bundeswehr auszugeben. Die Ukraine sollte mit Waffen unterstützt werden, um sich gegen den russischen Aggressor zu wehren. Mit dieser Rede und den ersten Schritte danach brach man mit mehreren Tabus der Bundesrepublik, die spätestens seit der Vereinigung 1990 in einen geopolitischen Dämmerschlaf verfallen war. Viele Medien waren beeindruckt, einige andere zeigten sich pflichtschuldig schockiert, sahen den aggressiven Deutschen wieder aufleben.
Zeiten ohne Wende heißt das Buch von Schweppe über diese Zeit, das Anfang Oktober erschienen ist. Ein Wortspiel. Der Untertitel nimmt das im Frühjahr bei Drucklegung sich abzeichnende Resultat bereits vorweg: »Anatomie eines Scheiterns«. Man liest die 350 Seiten trotzdem, in einem Rutsch, in einer Mischung aus Faszination und Widerwillen.
Schweppe schreibt eine Langzeitreportage, Stil und Ambition erinnern an Stephan Lamby. Immer wieder werden einige ausgesuchte Protagonisten besucht. Besonders häufig spricht er mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann (»Flak-Zimmermann«), jener FDP-Frau, die in hibbeliger Ungeduld und mit energischem medialen Auftreten den bei Waffenlieferungen für die Ukraine chronisch stockenden und zögernden Scholz mehrmals herausforderte. Er begleitet Daniel Andrä, zu Beginn 43, Oberstleutnant, zunächst Kommandant eines internationalen Gefechtsverbands in Litauen. Man lernt Matthias Lehna kennen, Mitte 30, einen ehemaligen Gebirgsjäger, der in Mali war. Beide werden am Ende über die Bundeswehr und den Umgang in ihr und mit ihr desillusioniert sein.
Schweppe zeichnet Portraits von Alfred Mais, Deutschlands oberstem Heeresgeneral und Ingo Gerhartz, dem »Chef« der Luftwaffe – beide könnten nicht unterschiedlicher sein. Aber auch Armin Papperger, der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, wird beäugt. Er schaut dem Haushälter Tobias Waldhüter über die Schulter (dabei bekommt man interessante Einblicke in die sogenannte »Nacht der langen Messer«, in der »der finale Haushalt für das neue Jahr ausgedealt« wird), begleitet den Nachrücker Nils Gründer, der »in der FDP-Arbeitsgruppe Verteidigung« arbeitet, zitiert den ehemaligen Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels und erlebt die amtierende Wehrbeauftragte Eva Högl, die zwar alles zu wissen scheint, was die Mangellage der Bundeswehr angeht, aber irgendwie wirkungslos bleibt.
Manche Treffen wirken wie pflichtschuldige Protokolle, weil sie keinerlei Erkenntnisgewinn liefern. Etwa bei Agnieszka Brugger, die überzeugt ist, dass die Bundeswehr im »Ernstfall« besser funktionieren würde, als manche Schlagzeile vermuten lasse. Dass es nicht »Ernstfall« heißt, wissen beide anscheinend nicht, was ein bisschen peinlich ist, wenn man sich gleichzeitig darüber amüsiert, dass Verteidigungsministerin wie Bundeskanzler von »Luftabwehr« (statt Flugabwehr oder Luftverteidigung) sprechen. Er scheint auch Brugger zuzustimmen, die meint, dass die »Zeitenwende« zu sehr von Männern dominiert würde. Eine merkwürdige Feststellung, schließlich ist zu diesem Zeitpunkt Christine Lambrecht Verteidigungsministerin, Eva Högl Wehrbeauftragte, Annalena Baerbock ist omnipräsent und sieht sich auch schon einmal mit Russland im Krieg und Strack-Zimmermann beherrscht die innenpolitischen Schlagzeilen.