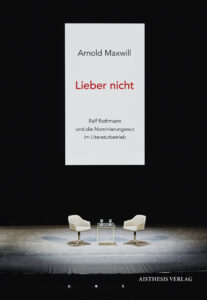
Da hört der Literaturwissenschaftler Arnold Maxwill 2023 ein Interview mit dem Schriftsteller Ralf Rothmann auf WDR5 und ärgert sich, dass nach noch nicht einmal zwei Minuten die Rede auf Rothmanns Absage, sein Buch zum Deutschen Buchpreis 2015 einzureichen, thematisiert wird. Die Causa scheint, so Maxwill, »wichtig genug, um sie gleich an den Anfang zu stellen«. Nun, sie ist offenbar derart wichtig, dass man darüber nach inzwischen zehn Jahren ein Buch über 77 Seiten plus 265 Anmerkungen auf weiteren 43 Seiten schreibt.
Durch seinen Verlag Suhrkamp hatte Rothmann 2015 ausrichten lassen, seinen Roman Im Frühling sterben nicht zum Deutschen Buchpreis einzureichen. »Ich möchte nicht«, so lautet die Formulierung, die er hierfür verwendet haben soll. Eine Paraphrase der Melville-Figur Bartleby, der in seiner Position als Angestellter mit »I would prefer not to« passiven Widerstand seinem Chef und überhaupt der Welt gegenüber leistete. Maxwill nennt denn sein Buch passend Lieber nicht.
Schon 2008 hatte Peter Handke den Börsenverein gebeten, seine Erzählung Die morawische Nacht, die auf der Longlist gelandet war, zu entfernen, um jüngeren Autoren den Vorrang zu geben. Ab und an kommt Maxwill auf Parallelen zwischen Handke und Rothmann zurück. Sein Fokus liegt jedoch eindeutig auf Ralf Rothmanns Textgenese, seinem Umgang mit Manuskripten und dem (leider notwenigen) Literaturbetrieb im speziellen und allgemeinen.
Aber das dauert. Zunächst hat der Leser eine Suada über die Unzumutbarkeit des Buchpreis-Prozedere zu überstehen. Neues gibt es dabei nur wenig. Da ist von einer »Lawine der Beanspruchung« durch die Vergabeprozedur (die fast immer als »Verleihung« bezeichnet wird, dabei wird der Preis nicht »verliehen«, sondern vergeben) die Rede, von der »Kompromissakrobatik« der Jury, dem (zugegeben perversen) Anspruch, den »besten Roman des Jahres« zu küren. Schriftsteller werden generell als hypersensible Persönlichkeiten dargestellt, denen es nicht zuzumuten sei, öffentlich als Verlierer eines Auswahlverfahrens gedemütigt zu werden. Überraschend, dass die ähnlich aufgezogenen Buchpreise etwa aus Leipzig, Bayern, Österreich und der Schweiz kaum Erwähnung finden. (Nur einer, der Schriftsteller Alain Claude Sulzer, beklagte 2022 in einem offenen und ehrlichen Text die empfundene Demütigung, zwei Mal für den Schweizer Buchpreis nominiert worden, aber jedes Mal preislos geblieben zu sein.) Und sind die Autoren, die beispielsweise für den Booker-Prize nominiert und »gelistet« werden, einfach resilienter? Schließlich fragt man sich noch, was wohl die Oscar-Nominierten Jahr für Jahr für Seelenqualen zu erleiden haben, wenn ihr Name nicht aufgerufen wird.
Als Quellen für die Zumutungen dienen merkwürdigerweise vor allem Einträge um 2007/2008 herum aus dem inzwischen eingestellten Lesesaal der FAZ, aber auch Kommentare und Analysen jüngeren Datums mit der Hauptquelle taz. Deren Autor Dirk Knipphals müsste fast als Co-Autor von Lieber nicht genannt werden. Zwischenzeitlich bekommt man den Eindruck, die ausgewählten Schriftsteller würden über die Monate der Preisfindung und – wie furchtbar! – öffentlichen Diskussion über ihre Bücher einer Psycho-Folter unterzogen. Nur wahre Helden wie Daniel Kehlmann, Bodo Kirchhoff und Wilhelm Genazino widersprachen, wobei suggeriert wird, dies könne man nur, wenn man ökonomisch abgesichert sei. Maxwill klärt leider nicht auf, inwiefern dies bei Genazino oder Kirchhoff der Fall gewesen sein soll.
Am Schlimmsten ist es aber für den Gewinner. Kronzeugin ist Julia Franck, die 2007 für ihren Roman Die Mittagsfrau ausgezeichnet wurde. Insgesamt wurde das Buch in 40 Sprachen übersetzt und sieben Millionen Mal verkauft. Franck hingegen beklagt sich. Hätte sie gewusst, welche Verpflichtungen der Preis nach sich gezogen hätte – sie würde es nicht noch einmal machen. Auch andere, wie Kathrin Schmidt, hatten wenig »Erfreuliches zu berichten«, klagen über Beanspruchungen, die sie von ihrer Profession, dem Schreiben, abgehalten haben. Immerhin kann man im geschwätzigen Anmerkungsapparat nachlesen, dass Uwe Tellkamp seinen Erfolg von Der Turm anders betrachtet hat. Im Übrigen scheint die Bemerkung, die Jury habe Tellkamps Buch aus verkaufstaktischen Gründen gegenüber Marcel Beyers Kaltenburg vorgezogen, die sich Maxwill zu eigen macht, ist ziemlich skurril. Der verwickelte Tausendseiter Der Turm ist nun wirklich kein eingängiges Buch. Mein persönlicher Favorit der Absurditäten ist allerdings die glücklicherweise in einer Anmerkung versteckte Behauptung, die Jury habe 2015 mit der Prämierung von Frank Witzels (freundlich ausgedrückt: sperrigem) Roman Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 unmittelbar auf Rothmanns Absage reagiert, um dem »Kulturbetrieb zu beweisen, dass der Deutsche Buchpreis nicht nur eine Marketingmaschine ist […] sondern durchaus in der Lage ist und den Mut und das Selbstbewusstsein besitzt, sehr eigenwillige Prosa […] auszuzeichnen.«
Nun will man nicht die Empfindungen von Franck und Schmidt leichtfertig abtun. Sie haben nun einmal diesen Preis nachträglich als Zumutung empfunden. Mit vielen Konjunktiven will Maxwill nun erkannt haben, dass hierin eine der Ursachen für Rothmanns Nominierungs-Weigerung zu sehen ist. Im weiteren Verlauf des Buches zieht er noch die Herkunft des Dichters, die Art und Weise seiner Schreibaskese und die Distanz »schicken Cliquen« gegenüber als weitere Begründungen heran und ergründet mehrmals die »innere Notwendigkeit« des Rothmann’schen Schreibens, die mit einem Auswahlprozess in der Öffentlichkeit nicht konvertierbar ist.
Die vorgebrachten Fürsorglichkeiten den armen Dichterseelen gegenüber, die vermutlich deshalb umfassend wie nervtötend mit Doppelpunktgenderitis ausgestattet werden, verstellen den Blick auf die realen Ambivalenzen dieses Monstrums Buchpreis. Nachdem zunächst eine Quotierung der Nominierten nach Geschlechtern thematisiert wird, findet sich immerhin in Anmerkung Nummer 70 die Quotierung der sich hochtrabend nennenden »Akademie Deutscher Buchpreis«: Buchhandel, Verlage und die Deutsche Bank-Stiftung stellen bzw. schicken je zwei Personen. Literaturhaus Frankfurt und Goetheinstitut entsenden jeweils einen. Es gibt einen Literaturkritiker und als »Vorsitzende die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Frau Karin Schmidt-Friderichs«, die, wie Maxwill richtig bemerkt, stark mit dem Buchhandel verknüpft ist.
Womit das Grundproblem auf dem Tisch liegt. Aber ist es überhaupt ein Problem? Akademie und die jährlich wechselnden Jurys sprechen eine eindeutige Sprache: Der Deutsche Buchpreis ist ein Buch- und eben KEIN Literaturpreis. Trotz des großspurigen Gehabes. Die Mehrheit der Entscheidungsträger kommen direkt oder indirekt aus dem stationären Buchhandel. Es geht um Verkäuflichkeit und damit eben auch oder, salopp wie bösartig formuliert, um außerliterarische Dinge. Und das hat, wie die Preisträger der letzten Jahre nahelegen, noch zugenommen. Wie auch, was nur angedeutet wird, die Anzahl der literarischen Debüts, die den Buchpreis fast schon als eine Art Nachwuchswettbewerb erscheinen lassen. Umso unverständlicher, dass sich Maxwill so stark auf die im Internet-Archiv aus der Wikipedia geklaubten Lesesaal-Artikel aus Ende der 2000er Jahre stützt, statt den Preisträgern und Nominierungen der letzten Jahre auf den Grund zu gehen. Immerhin: Beim Phänomen Kim de l’Horizon konstatiert Maxwill sogar, die Jury habe »alles richtig gemacht und die Gunst der Stunde genutzt«. Und wieder dient ein Knipphals-Text in den Anmerkungen als Widerspruch gegen den Widerspruch darauf. Konsistent ist die Argumentation von Maxwill nicht (wenn man denn überhaupt eine Argumentation erkennt).
Interessant die übernommene Annahme, jeder Juror lese tatsächlich vollständig die rund 200 eingereichten Titel. Ein konzentriertes Lesen dieser Textmenge in knapp fünf Monaten dürfte schlicht unmöglich sein, selbst wenn es sich, wie Maxwill zitiert, um »professionelle« Leser handelt. Hier wäre endlich Klarheit angebracht, nach welchen Kriterien (notwendige) Vorauswahlen getroffen werden, aber es herrscht bei derartigen Jurys immer noch einer Art Omertá. Wenn dann mal jemand Einblicke in fragwürdige Setzungen der Entscheidungsfindung liefert, wie Juliane Liebert und Ronya Othmann anlässlich des Internationalen Literaturpreises des HKW Berlin 2023, wird sofort das große Fass vom »Vertrauensbruch« aufgemacht und Insa Wilke bemüht gar »presseethische Dimensionen«, weil man solche Berichte über Jurysitzungen publiziert habe.
Auch Maxwill ist nicht verborgen geblieben, dass unter den zahlreichen »Belletristik«-Neuerscheinungen das Mittelmaß dominiert (freundlich ausgedrückt). Abermals versteckt in einer Anmerkung spricht er von 700 Literaturpreisen in Deutschland (Stand: 2004). Inzwischen gelten selbst Stipendien als »Preis« und werden von Autoren in ihrer Biographie bisweilen wie Trophäen aufgeführt. Die Folge ist, dass in den Medien solche Auszeichnungen gar nicht mehr wahrgenommen werden. Hierin lag einer der Gründe für den Leipziger und den Deutschen Buchpreis. Die Branche wollte wieder mehr Sichtbarkeit und Medienanteilnahme. Vielleicht speist sich das Unbehagen am Frankfurter Preis auch am Sponsor – der Deutschen Bank. Deren »kriminelle Energie« sollte man, so Maxwill, durchaus einmal genauer untersuchen.
Untersuchen sollte man vielleicht die Behauptung, die Vergabezeremonie kostete das Zehnfache des Gewinner-Preisgeldes, nämlich, so steht es bei Maxwill in Anmerkung 37, »250.00 Euro«. Gemeint sind natürlich 250.000 Euro. Ein stolzer Betrag. Als Quelle wird »Sandra Vlasta: Aufmerksamkeit und Macht im literarischen Feld – der Deutsche Buchpreis, in: Aussiger Beiträge 10 (2016), S. 13–26, hier S. 19« angegeben. Die Zahl findet sich im frei herunterladbaren Text von Vlasta tatsächlich. Hier wird als Quelle »The winner takes it all. Der Deutsche Buchpreis im Profil. In: Spiel, Satz und Sieg. 10 Jahre Deutscher Buchpreis. Hrsg. v. Ingo Irsigler u. Gerrit Lembke. Berlin: Berlin University Press, S. 11–28« genannt. Vielleicht ist dort das Geheimnis verborgen, wie sich diese 250.000 Euro zusammensetzen. Aber warum hat Maxwill, der aus dem Buch von Irsigler/Lembke andernorts sechs Mal zitiert, nicht erläutert, was dort über diesen Betrag hinterlegt ist?
Der interessanteste Teil des Buches ist tatsächlich die Auswertung aus mehreren Rothmann-Gesprächen der letzten rund zehn Jahre (bspw. aus 2016, 2019, 2020, oder 2023). Das Cover mit den beiden leeren Stühlen passt dazu allerdings dann nicht mehr. Maxwill destilliert aus den Gesprächsaussagen Rothmanns eine Genese seines Schaffens und eine Art Idealbild eines Schriftstellers, der still und zurückgezogen als eine Art Hieronymus im Gehäus Inspiration sucht und bisweilen auch zu finden scheint. Dann gibt es noch einen Rekurs auf den Literaturpreis Ruhr. Auch hier verzichtete Rothmann auf eine weitere Nominierung, nachdem er bereits 1996 den Preis unter allerdings anderen Vergabekriterien erhalten hatte. Maxwills Geschichte und neue Interpretation dieses Literaturpreises mit ihren Merkwürdigkeiten ist ziemlich informativ.
Wie notwendig eine Kritik am Deutschen Buchpreis und dessen Anspruch ist, vermag man an einem kleinem Detail zum aktuellen Verfahren 2025 erkennen. Es geht um die sogenannten »Buchpreisblogger*innen«, also Social-Media-Kanäle, die sich mit Büchern und, seltener, mit Literatur beschäftigen und seit einigen Jahren von den Veranstaltern ähnlich wie die Jury »nominiert« werden. Sie sollen sich über die Bücher der Long- bzw. Shortlist auslassen und neugierig machen. In der Vergangenheit fand man dafür bisweilen durchaus kompetente Protagonisten, die »ihr« Buch vorgestellt und besprochen hatten. Mit der Auswahl für 2025 hat man sich jetzt deutlich von jeder Form der seriösen Vermittlung verabschiedet und mehrheitlich Instagram-Kanäle nominiert. Das Influencertum, jene sich exponentiell verbreitende hirnzersetzende Seuche, die jeden Unsinn gegen entsprechendes Geld zu Verkaufszwecken lobhudelt, wurde damit jetzt auch für den Buchmarkt offiziell nobilitiert. Ein weiterer Beleg dafür, dass der Deutsche Buchpreis mit Literatur inzwischen soviel zu tun hat wie ein Monobloc mit einem Lounge Chair.
Und trotzdem wird auch weiterhin kaum jemand darauf verzichten wollen, nominiert zu werden.
