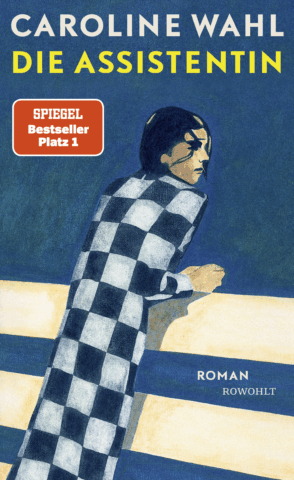
Charlotte Scharf ist 1996 geboren, Einzelkind, obere Mittelschicht, aus dem Speckgürtel um Köln, abgeschlossenes Master-Studium. Sie bewirbt sich als Assistentin des Verlegers eines renommierten Münchner Verlags. Es soll wohl eine Art Emanzipation vom Elternhaus sein, vor allem von der Mutter, mit der sie eine Hassliebe verbindet. Aber wahrscheinlich, so wird der Leser von Caroline Wahls Roman Die Assistentin zu Beginn von der allwissenden Erzählerin belehrt, war es halt nur ihr Vaterkomplex, der sie zur Bewerbung veranlasste. In jedem Fall aber eine »riesengroße Fehlentscheidung«. Oder doch nicht?
Der designierte Chef heißt Ugo Maisel, ein Münchner Lebemann, ehemaliger Tennisspieler (Platz 348 auf der ATP-Weltrangliste und 1 x Agassi geschlagen), Buchautor (mässiger bis gar kein Erfolg) und jetzt führt er diesen Verlag. Er hat eine Narbe im Gesicht (einen Schmiss?), sieht sehr kränklich aus und es beginnt der Haarausfall. Charlotte erhielt eine Zusage, allerdings für einen etwas anderen, zweitrangigeren Assistentinnenjob, aber das war ihr egal. Sie zog nach Ismaning in ein Stephen-King-ähnliches Haus, in dem unter anderem im Jahr ihrer Geburt eine Leiche gefunden worden war, aber immerhin war die Wohnung am Wasser und das war ihr wichtig.
Was nun folgt ist eine mehr oder weniger chronologische Schilderung von Charlottes Assistentinnentortur von September bis Februar, mit vielen Höhen und Tiefs und vor allem etlichen metafiktionalen Einschüben, die rasch erkennen lassen, dass hier eine Autorin auch das zielgerichtete Schreiben ihres Romans hin zu einem Bestseller thematisiert. So überlegt sie auf Seite 110, wie sie den Text von einer Erzählung oder Novelle (nicht so ganz marktkonform) in einen Roman überführen kann. Und schreibt noch 250 weitere Seiten (statt vielleicht nur weitere 100). Passend dazu dichtet sie Charlotte eine Liebesaffäre an (er heißt Bo), damit es weitergeht. Oder sie fällt sich ins Wort, wenn es zu viel oder zu wenig anekdotisch zu werden droht. Als wäre das nicht genug, baut sie auch noch innerhalb der nummerierten Kapitel kleinere Cliffhanger ein, die je nach Lage bald große oder mindestens mittlere Katastrophen andeuten oder erläutern, dass eigentlich erwartbare Katastrophen vorerst ausbleiben.
Ugo Maisel (Kürzel: mu – im Verlag sind alle Leute mit Kürzeln belegt; der Verleger gibt jeder Assistentin zusätzlich noch ein Obstemoji, wobei Charlotte die Erdbeere ist) stellt sich als anstrengender Exzentriker mit stark schwankenden Stimmungen heraus, die man (respektive Charlotte) an seinen Marderaugen bisweilen glaubt, erkennen zu können. Sind diese glasig, beginnt die Bipolarreise, die nur zwei Reaktionen zulässt: Faust in der Tasche oder Flucht. Die dritte Möglichkeit, der Widerspruch, die Verteidigung, wäre grundfalsch. Aber er kann auch albern und charmant sein.
Zunächst bekommen die beiden neuen Assistentinnen Blumen, einen E‑Reader und ein »Manual« geschenkt. In letzterem sind ausführlich die Arbeits- und Umgangsregeln formuliert, die peinlich genau einzuhalten sind. So sind jeden Morgen Geburtstags- und Terminlisten auszudrucken und hinzulegen (nachdem oder während man das Büro, das nach Kaschmirziege stinkt, ausgiebig gelüftet hat). Es ist sehr wichtig, wann welcher Löffel gereicht wird und wenn »mu« zum Beispiel zum Mittagessen eine Nudelsuppe in einem nahegelegenen Restaurant bestellt, muss nicht mehr erwähnt werden, dass sie ohne Nudeln serviert werden muss (»Kapitel 9.2.1.1.«). Beim Chicken-Bowl wird es zu Charlottes Markenzeichen, dass sie das Hühnchen vor dem Servieren noch einmal aufbrät.
Drei Mal wird im Roman der Film Der Teufel trägt Prada erwähnt, in dem Meryl Streep in der Rolle einer Modemagazin-Macherin ihre neue, zunächst leicht trampelige Assistentin (gespielt von Anna Hathaway) nach allen Regeln der Kunst terrorisiert. Nach einiger Zeit hat diese allerdings die speziellen Wünsche und Allüren ihrer Chefin inkorporiert, agiert, wie man heutzutage sagt, proaktiv und antizipiert mögliche Probleme und Fallstricke. Und das passiert im Mittelteil der ausufernden Geschichte bei Charlotte und ihrem »mu« eben auch. Sie erkennt zwar die Wankelmütigkeit und macht sich über bestimmte Verhaltensweisen des Verlegers lustig, will aber zugleich die Auserwählte sein. Das wird dann Realität, weil Ivana, die mit ihr eingestellt wurde, rasch aufgibt. Später wird eine neu eingestellte, zweite Assistentin, ebenfalls nach wenigen Wochen aufgeben (nahezu alles, was über diese Jeanne erzählt wird, ist überflüssig, aber damit füllt man halt einige Seiten). Der Verschleiß an Assistentinnen zeigt sich unter anderem daran, dass die Obstemojis ausgehen und jetzt erstmalig ein Gemüseemoji verwendet wird.
Charlotte entwickelt Ehrgeiz, findet zeitweise echte Befriedigung in diesem Job, obwohl der Verleger immer wieder Fehler in ihrer Arbeit findet, die dann fast lustvoll ausgebreitet werden. Freilich leidet ihr Privatleben und ihre wieder aufgeflammte Ambition, das Texten und Komponieren von Musik, leidet darunter, da Maise auch an Wochenenden zuverlässig Wünsche äußert. Als es auf die Weihnachtszeit zugeht, arbeitet Charlotte strategisch, lobt besonders oft den Chef für Nichtigkeiten, bekommt aber aufgrund ihres Einsatzes auch besonders viel Lob. Sie weiß, dass er irgendwann über einen Weihnachtsbonus entscheiden wird. Der fällt dann mit fast 10.000 Euro (netto) üppig aus. Es ist das einzige Mal, dass man annäherungsweise etwas über ihr Gehalt erfährt. Bestand der Bonus aus einem oder zwei Monatsgehältern? Egal – sie nutzt ihn, um ihr Studioequipment aufzurüsten. Insgeheim sieht sie sich immer mehr als Musikerin, hat mittlerweile fertige Songs. Auf Instagram legt sie unter »iCharli« einen Account an.
Mit dem fein-ironischen Büroroman eines Walter E. Richartz vom Ende der 1970er-Jahre hat dieser Klimbim gar nichts zu tun, aber manche Schrullen des Verlegers sind wirklich lustig und deren Ausbreitung durch eine übereifrige Erzählerin lassen den Leser, der ungefähr ab Seite 14 keine hohe Literatur mehr erwartet, bisweilen schmunzeln. Obwohl mehrfach angekündigt, wird dann irgendwann erklärt, dass der Zusammenbruch, die ultimative Katastrophe, ein Prozess sei, der in einem veritablen, zunächst als Herzinfarkt empfundenen, Nervenzusammenbruch kumuliert. Der genaue Ausgang des Romans soll im Interesse der »Bestseller-Autorin« (Deutschlandfunk Kultur) nicht verraten werden. Nur so viel: Die heilige Hedwig vom Mutterhof grüßt von Ferne.
Natürlich gehen einige Kritiken der Autorin auf dem Leim und suchen nach Übereinstimmungen zwischen Ugo Maisel und der Wirklichkeit. Hatte nicht Caroline Wahl einst ein Praktikum in Zürich gemacht? Andere sehen hier sozial-feministische Anliegen: die Frau als ausgebeutetes Subjekt. Metafiktional wird von der Autorin überlegt, ob die gelegentlichen (eher unabsichtlichen) Berührungen des Verlegers oder die rhetorischen Übergriffigkeiten (er fragt sie andauernd, ob sie verliebt sei) schon Belästigungen sind. Ein Spiel mit Betroffenheit.
Die größte Beleidigung für den Betrieb scheint darin zu liegen, dass die neurotische Unternehmerpersönlichkeit ein Verleger ist. Caroline Wahl als Nestbeschmutzerin. Dabei wäre es mit wenig Aufwand möglich, aus dem Verleger einen Inhaber einer Werbeagentur oder den geschäftsführenden Gesellschafter eines Handelsunternehmens zu machen. Verlagsspezifisches Arbeiten ist eine Seltenheit in diesem Roman und spielt keine relevante Rolle. Selbst wenn es um ausgedruckte Manuskripte geht, bleiben diese lediglich Papierkonvolute, die in Kartons oder Jutebeuteln zum Transport verpackt werden. Hier liegt Kalkül vor. Und das ist besonders lustig.
Da es sich bei Die Assistentin um reinen Midcult handelt, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Roman für das Fernsehfilm-Verblödungsprogramm irgendeines öffentlich-rechtlichen Senders zurechtgeschrieben wird. (Natürlich darf Charlotte dann nicht mehr rauchen.) Ich empfehle Lars Eidinger als Ugo Maise.
