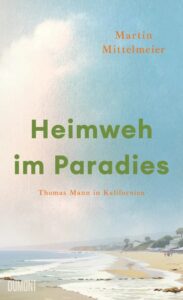
Heimweh im Paradies
»Goethe in Hollywood« überschreibt der Literaturwissenschaftler Martin Mittelmeier das erste Kapitel seines Buches Heimweh im Paradies über Thomas Manns Jahre in Kalifornien. Nach fünf Jahren im Exil in der Schweiz übersiedelte die Familie 1938 in die USA. Und natürlich darf er nicht fehlen, der Satz, mit dem er sich selber zur zentralen Figur des Deutschen im Exil gegen das Nazi-Regime machte: »Wo ich bin, ist Deutschland«. Eine Mischung aus Anmaßung, Trotz und Selbstbehauptung.
Dabei war es ein »anderes« Land, dass sich dem Dichter zeigte; nicht nur die andere Sprache, die der 63jährige mühsam lernte. Ein Land mit Filmstudios, Einladungen, Reden, Lesereisen, Zusammenkünften mit den anderen Exilanten, die schon länger in den USA lebten. Die Weltanschauungen lagen zum Teil weit auseinander und einige verstanden etwa den Bruder Hitler nicht. Thomas Mann zog rasch Aufmerksamkeit auf sich; es kam zu Begegnungen mit dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt. Viel Neues für jemanden, den einige bereits damals für einen Mann des 19. Jahrhunderts hielten. Nach einer Gastprofessur in Princeton präferierte er den Osten, ging ins Umland von Los Angeles, dort, wo das »Movie-Gesindel« lebte, schließlich Pacific Palisades, ab Februar 1942 in einem eigens errichteten Haus.
Mittelmeiers chronologisch angelegtes Buch liest sich phasenweise wie ein Roman. Person, Werk und Zeitläufte greifen ineinander. Immerhin entstehen drei bedeutende Werke während dieser Zeit: Lotte in Weimar, der vierte Joseph-Roman und vor allem Doktor Faustus, mit er am 23.3.1943 begann. Manchmal hat man bei der Lektüre das Gefühl, noch einmal Heinrich Breloers Die Manns beizuwohnen und sieht im Geiste Armin Müller-Stahl die Püppchen auf dem aus der Schweiz eingetroffenen Schreibtisch an ihren Platz stellen. Mittelmeier kriecht förmlich in das Wesen von Thomas Mann ein, weiß von einem zeitweise auftretenden Blues seinem Werk gegenüber zu berichten und skizziert die Überwindungen zu Treffen mit den anderen Exil-Autoren und deren Egos. Genau geschildert wird Manns Andienen und Aushorchen an Theodor Adorno, um sich die Musik Arnold Schönbergs für seine Figur des Adrian Leverkühn im Faustus-Roman zu erschließen.
Natürlich gibt es auch familiär-intimes, etwa Thomas Manns Präferenzen, was seine Kinder angeht oder das Verhältnis zum Bruder. Die Betrachtungen eines Unpolitischen sind inzwischen zwanzig Jahre alt und er muss sich eingestehen, dass Heinrich damals Recht hatte. Aber Thomas ist jetzt, wie es einmal heißt, »demokratisiert«, wenn er auch der Massendemokratie skeptisch gesonnen bleibt, aber mit den Jahren das Soziale zu entdecken scheint, was im Nachkriegsamerika irgendwann genügt, um kommunistischer Umtriebe verdächtig zu sein.
Thomas und Heinrich: Hier der »Kulinariker der Sehnsucht«, der im »Korsett des Bürgerlichen« in der literarischen Form das Wilde bändigt und mit dem Zauber der Ironie die Welt bannt und dort der dionysische »Kulinariker der Lust«, weniger bekannt und im Gegensatz zu Thomas permanent in notorischer Geldnot. Heinrichs Bücher verkaufen sich schlecht, während die Werke seines Bruders rasch reüssieren und übersetzt werden. Nicht zuletzt dank Agnes E. Mayer, die er 1937 kennenlernte, Mäzenin und gelegentlich »tyrannischer Förderin«. So gab es zwei Frauen, die ihm den Rücken für sein Schreiben freihielten – Katia und Mayer. Wenn da nicht diese Repräsentationspflichten gewesen wären. Im Laufe der Jahre, so erscheint es nachträglich, war Thomas Mann zu einem Symbol geworden, »das er nicht mehr kontrollieren« konnte.
Mittelmeiers Buch ist eine Collage aus historischen Quellen, Briefen, Tagebucheintragungen, Erinnerungsbüchern und literaturwissenschaftlichen Studien. Letztere werden gerafft, um die Grundzüge von Thomas Manns Ironie zu entwerfen. Manche Anekdötchen sind bekannt, vielleicht über die Jahre ein bisschen zu oft strapaziert worden, wie etwa die Reibereien innerhalb der Exilantenszene, die ewige Frage, warum er explizit für die Buddenbrooks und nicht für den Zauberberg den Nobelpreis bekommen habe oder der Besuch der 16jährigen Susan Sontag. Aber man kann so etwas nicht weglassen. Weniger bekannt etwa der Hinweis auf zwei Goethe-Zitate im Schlussplädoyer des britischen Hauptanklägers im Nürnberger Prozess, welche in Wahrheit vom Goethe aus Lotte in Weimar, also von Thomas Mann, stammen. Schön erzählt wird auch die Schiffsreise von Thomas und Katia 1947 von Europa zurück in die Staaten und die Begegnungen an Bord mit Max Beckmann und Frau »Quappi«. Zwischenzeitlich glaubt man, Mittelmeier wolle dem Leser unbedingt die Lektüre des Doktor Faustus nahebringen. Das wäre nicht das Schlechteste.
Gewinnend ist der lockere, aber nie seichte Erzählton, den man zunächst mit Florian Illies vergleichen könnte. Das würde Mittelmeier allerdings unrecht tun, denn er enthält sich glücklicherweise der wohlfeil-sensationalistischen Konstruktionen des »könnte-vielleicht« oder anderer Mutmaßungen. Im Gegensatz zu Illies bietet Mittelmeier mittels QR-Code auf der Webseite des Verlages seine Quellen detailliert an (bleibt zu wünschen, dass die Seite lange erhalten bleibt). Der Autor dankt am Ende für die »Lässigkeitsermutigung« und es ist genau diese ernsthaft grundierte Nonchalance, die den Ton dieses unterhaltsamen wie lehrreichen Buches ausmacht.
Schade ist einzig der Titel, der mindestens missverständlich ist. Nein, ein Paradies waren diese Jahre in den USA trotz des großbürgerlichen Ambiente und der gesicherten Einkünfte nicht oder nur selten. Dass Thomas Mann das Exil nie genießen konnte, konstatiert Mittelmeier am Ende selber. Da waren die McCarthy-Umtriebe, die auch vor ihm nicht Halt machten, nur der letzte Auslöser, der die Entscheidung, das Land zu verlassen, besiegelte. Im Juni 1952 kehrte Thomas Mann einfach nicht mehr in die USA zurück. Er blieb in der Schweiz. »Nach Deutschland zu gehen, war keine Option«, schreibt Mittelmeier und es gab gute Gründe, um »sich Deutschland nur aus der sicheren Ferne…zu Gemüte zu führen«. Schließlich, so er treffende Befund, habe Thomas Mann Deutschland »ja in sich, das äußere erträgt er nicht.« Kein Paradies. Aber auch kein Heimweh. Es sei denn an eine Zeit, die längst vergangen war.
Verblüffend, wie nahe einem für den Augenblick der Lektüre dieser Thomas Mann kommt.
