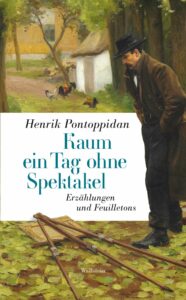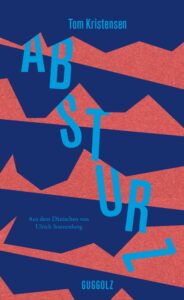
Ole Jastrau ist 34 Jahre alt, verheiratet mit Johanne, hat einen dreijährigen Sohn Oluf, lebt in Kopenhagen und rezensiert dänischsprachige Bücher beim »Dagbladet«. Es ist Frühjahr 1929, ein Tag vor einer Wahl zum dänischen Folketing. Die Rezensionsexemplare stapeln sich bei ihm in der Wohnung; er muss lesen und vor allem schreiben, kann sich aber nur schwer konzentrieren. Plötzlich klingelt es an der Tür. Zunächst erkennt er den »Kommunistenbengel« Bernhard Sanders nicht, vermutlich, weil er ihn an seine eigene politische Vergangenheit erinnert. Er ist in Begleitung eines gewissen Stefan Steffensen, der eigentlich Stefani heißt, und der Sohn einer angesehenen Kopenhagener Persönlichkeit ist, des Dichters und Apothekers H. C. Stefani. Auch Steffensen scheibt Gedichte.
Die beiden bitten um Asyl für eine Nacht, um eine drohende Haftstrafe wegen Verbreitung ihrer kommunistischen Zeitschrift nicht absitzen zu müssen. Ihre Spekulation geht dahin, dass bei einem Wahlsieg der Sozialdemokraten eine allgemeine Amnestie für solche Fälle ausgesprochen werden dürfte. Die Gäste bedienen sich gerne und lassen sich noch lieber aushalten. Jastrau gilt beim blitzgescheiten Sanders als Renegat, der seine einstigen Ideale verraten habe und er läßt keine Gelegenheit aus, ihm dies mitzuteilen. Nebenbei wird das »Dagbladet« als »Lügenblatt« bezeichnet. Johanne zeigt sich von dem Besuch nicht begeistert. Sie kocht zwar für die beiden mit, reist dann jedoch mit Oluf zu den Eltern. Jastrau geht in die Redaktion.
Das ist die Ausgangssituation für Absturz, des 1930 erstmals veröffentlichten Romans des dänischen Schriftstellers Tom Kristensen (1893–1974), den der Guggolz-Verlag in einer neuen Übersetzung von Ulrich Sonnenberg herausgebracht hat. Kristensen nahm sich auf den 620 Seiten Zeit, viel Zeit. Mit großer Behutsamkeit wird der Leser in die Charakterrollen, Freund- wie Feindschaften, Ränkespiele und Geheimnisse von Journalisten und Kopenhagener Kulturschickeria herangeführt. Da ist die »Rattenwache« zum Beispiel, in der nach Feierabend Redakteure die Papierkörbe ihrer Kollegen ausleeren, zerrissene Zettel zusammensetzen und auf diese Art zuerst an Informationen über brisante Recherchen kommen oder Privates von ihren Kollegen erfahren. Die älteren Redakteure leben häufig in prekären Verhältnissen, sind desillusioniert, dem Alkohol verfallen. Ihr Stammlokal ist die »Bar des Artistes« nebst anliegendem Hotel, ein Kosmos, der hinter einer schweren, dunklen Portiere eine andere Welt offenbart, in der die gültigen Hierarchien und Wertvorstellungen außer Kraft gesetzt sind. Hier sitzen nur Männer, einige von ihnen tagaus, nachtein.