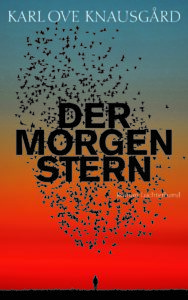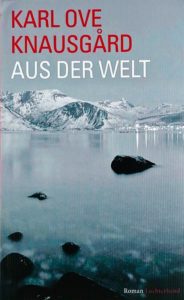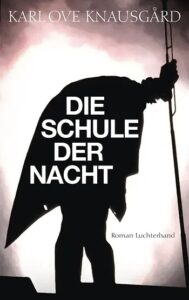
Karl Ove Knausgårds neuer Roman Die Schule der Nacht beginnt damit, dass der 44jährige Kristian Hadeland 2010 in einem Haus irgendwo auf einer norwegischen Insel sitzt und über sein Leben nachdenkt. Das Haus gehört einem reichen Investor, den er vor Jahren in London kennengelernt und der ihm vom Haus, der Ruhe und dem Plätzchen, an dem sich ein Schlüssel findet, erzählt hatte. Niemand weiß, dass er hier ist, außer die Nachbarn, aber die kennen ihn nicht. Bevor er sich das Leben nehmen wird, schreibt er es auf.
Ich-Erzähler Kristian beginnt mit seiner Erinnerung im August 1985, als er das erste Mal von Christopher Marlowe gehört hatte, dem englischen Dramatiker, der 1593 mit einem Messer im Auge in Deptford umgebracht wurde. In diesem Stadtteil von London lebt Kristian in einem Mietshaus (Dusche auf dem Flur) und studiert an einer Akademie Fotografie. Er lässt es eher ruhig angehen, lebt von einem Stipendium (und seinen Eltern) und verbringt die Abende in einem Pub. Hier lernt er Hans kennen, einen Holländer, den er zwar nicht besonders mag, aber man ist nun zu zweit Ausländer in London und spricht ausgiebig dem Bier mit Wodka zu. Hans ist ein »monomaner Leser« und Belehrer, sieht sich als Künstler, experimentiert mit computergesteuerten Apparaturen, etwa einer künstlichen Ratte, die einen Parcours durchlaufen kann oder Schildkröten, die sich wie heutige Staubsaugerroboter fortbewegen. Kristian liest sich lustlos durch Shakespeares frühe Werke, während Hans ihm von Marlowe erzählt, sein Stück über Doktor Faustus, das von einer lokalen Theatergruppe, die sich unter »School of Night« im Hinterzimmer des Pub trifft, demnächst aufgeführt werden soll. Er weiß, dass einige Marlowes Tod nicht akzeptieren, sondern glauben, er sei damals untergetauscht und habe unter Shakespeares Namen die inzwischen weltbekannten Stücke geschrieben. Hans zeigt Kristian auch das vermutlich erste Daguerre-Bild von 1938, stellt kühn die These auf, die einzige Figur, die dort zu sehen sei, wäre der Teufel und man fachsimpelt unter anderem über Aleister Crowley.
Kristian geriet in den Bann von Hans, weniger der Theatergruppe. Das Weihnachtsfest 1985 verbrachte er jedoch bei den Eltern in Norwegen. Es endete abrupt in einer Katastrophe. Seine Schwester Liv hatte einen Selbstmordversuch unternommen, der jedoch im letzten Moment entdeckt wurde. Abends hörte Kristian die Eltern im Gespräch. Der Vater, ein eher schweigsamer Großbauer mit eisernen Regeln, bezeichnete Kristian als »Vollblut-Narzissten«. Die Mutter, eine »Archivarin der Sentimentalität«, beschwichtigte vergeblich. Das konnte Kristian nicht auf sich sitzenlassen. Er packte in aller Heimlichkeit und verließ das Elternhaus ohne jeder Nachricht Richtung London. Am meisten betrübte ihn, dass er nicht seine ganze Plattensammlung mitnehmen konnte. Er schwor, mit den Eltern für immer zu brechen. In London angekommen, ergeht er sich in Selbstbespiegelungen und ‑beschwörungen. Ans Telefon geht er nicht, weil es die Eltern sein könnten. Einige Wochen später wird eine Angestellte der norwegischen Botschaft bei ihm klingeln. Einen Brief und eine Postkarte der Mutter, die er viele Monate später erhalten wird, warf er (nach Lektüre) in den Müll.