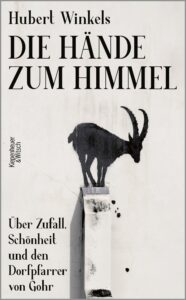
Die Hände zum Himmel
[...weit ausholend]
Niemand, der sich für zeitgenössische deutschsprachige Literatur interessiert, kam am in diesem Jahr 70 Jahre alt werdenden Hubert Winkels vorbei. Er schrieb nicht nur für zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften Kritiken und Essays (vom Düsseldorfer Stadtmagazin Überblick über Tempo, stern, ZEIT, Süddeutsche Zeitung und Spiegel), sondern war mehr als 25 Jahre im Literaturressort des Deutschlandfunks tätig. In nahezu allen relevanten Jurys fand man seinen Namen. Breite Wirkung erreichte er durch die Tätigkeit als Juror im Ingeborg-Bachmann-Preis; von 2015 bis 2020 war er der Jury-Vorsitzende.
Es sind zwei Ereignisse, die mich über alle bisweilen deutlichen Schwierigkeiten, die mit Winkels’ Kritiken hatte, mit ihm nicht nur verbanden, sondern in denen ich ihn mit gefasster Sympathie betrachtete (ich kenne ihn nicht persönlich). Zum einen Mitte/Ende der 1990er Jahre, als er für eine kurze Zeit im Dritten Programm des damaligen den Dichterclub moderierte. Die Sendung orientierte sich, wenn ich richtig erinnere, an die SWR-Bestenliste, die einst von Jürgen Lodemann als Gegenpol zu den Bestsellerlisten mitinitiiert wurde. Hier vergeben eingeladene Kritiker (fast) monatlich Punkte für (zumeist deutschsprachige) Neuerscheinungen nach ihren persönlichen ästhetischen Literaturkriterien. So entsteht eine Rangfolge der zehn »besten« Bücher. Zum großen Teil kommen Bücher auf diese Liste, die auf den gängigen Verkaufslisten nicht zu finden sind.
Winkels fungierte beim Dichterclub als mitmachender Moderator. Eine Redaktion suchte aus der Bestenliste vielleicht drei oder vier Bücher aus und stellte sie in unterschiedlichen Modi wie Kritikergespräch, Lesung eines Kapitels, Film mit oder ohne Autor und/oder persönlicher Empfehlung eines Kritikers vor. Das unterschied sich wohltuend sowohl von den im Befehlston den Leser gängelnden Empfehlungsfetischismus wie auch vom längst clownesk gewordenen Literarischen Quartett. Sie dauerte nach meiner Erinnerung eine Stunde, war aber kurzweilig, ohne trivial zu sein. Damit sie auch garantiert keinen Erfolg hatte, strahlte man sie auf SWF meist mittwochs gegen 23 Uhr und als Wiederholung auf 3sat Sonntag vormittags, um 10 Uhr herum, aus. Es findet sich noch eine Einschaltquote einer Sendung von 1998. Demnach wurden einmal 0,04 Millionen Zuschauer gemessen, was einem Marktanteil von 0,3% entsprach. Wenn man weiß, wie diese Zahlen ermittelt werden, weiß man auch, wie hoch die Fehlertoleranz in diesem Bereich sein kann. Immerhin, so sagt man sich, 40.000. Ob eine Radiosendung im Deutschlandfunk, sagen wir der Büchermarkt, eine ähnliche Quote hat? Aber, so könnte man fragen: Warum ist eine Quote überhaupt relevant?
Der Dichterclub wurde nach zwei oder drei Jahren eingestellt; es gab noch mindestens einen Versuch, die Bestenliste im Fernsehen aufzubereiten bis sie schließlich ins Radio wanderte und dort nun in Form eines einstündigen Kritikergesprächs über vier Bücher mit Ausschnittslesungen regelmässig ausgestrahlt wird.
Mein zweiter thymotischer Moment mit Hubert Winkels ereignete sich im Juni 2021. Winkels war eingeladen worden, im Rahmen der »Tage der deutschsprachigen Literatur« zu Klagenfurt die Rede zur Literaturkritik zu halten. Der Text wurden größtenteils mit einer Mischung aus Unverständnis und Verstörung wahrgenommen. Wolfgang Tischer vom Literaturcafé nahm dies zum Anlass, Winkels, der pandemiebedingt in Berlin war, zu befragen. Das Gespräch dauerte fast 40 Minuten und man erlebte den Kritiker, wie er losgelöst von allen Verpflichtungen (er war seit kurzer Zeit auch nicht mehr Redakteur beim Deutschlandfunk) über sein Verständnis von Literatur und Literaturkritik sprach.
Selten hat man einen Menschen aus dem Literaturbetrieb derart befreit reden hören. Er beschwor den »Funken eines magischen Weltverständnisses« als eine ästhetisches Ziel von Literatur. Dass die Rede auf Irritationen stoßen würde, nahm er bewusst in Kauf Und er haderte mit der aktuellen Literaturkritik, die sich immer mehr zeitgeistig gebe und als volkspädagogisches Instrument sehe. Ein schleichender Prozess sei das gewesen, so Winkels, aber all das war und vor allem: ist mit ihm nicht zu machen. Er hatte halt Glück, einen Kulturchef zu haben, der philologisch noch ambitionierter war als er selber und ihn schlicht »machen« ließ. All das wird in sachlichem, keinesfalls überheblichem Ton festgestellt.
➔ Hier weiter zum vollständigen Text »Rheinisches Hochgefühl und katholischer Zufall« mit der ausführlichen Besprechung von Die Hände zum Himmel bei Glanz und Elend.

Grammatikfehler noch und nöcher..
»Einer der ödesten Momente: wenn mitten in einem Gespräch über ein grammatikalisches Problem diskutiert wird«.
(Peter Handke, Das Gewicht der Welt)