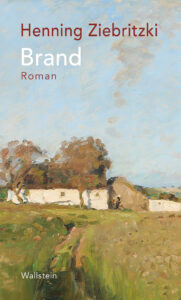
Brand ist der Name eines fiktiven Ortes, ein Dorf, irgendwo in der Region Hannover und es ist der Titel des ersten Romans des Schriftstellers und Essayisten Henning Ziebritzki. Es beginnt mit August, der anders ist, was der Erzähler aber schon wusste, bevor es ihm die Eltern erzählt hatten. August ist schweigsam, ein »Tach« beantwortet er entsprechend, ansonsten spricht er selten und träumt gerne. Er ist »Greis und Kind zugleich«, ein Döllmer, wie man dort sagt und das ist nicht herabsetzend gemeint, denn August hat eine wichtige Aufgabe im Dorf. Er muss im Frühling die im Winter unter dem Schnee hervorgekommenen Steine aus dem Boden heraussuchen, die ansonsten die Messer des Pflugs beschädigen könnten. Und er macht das mit Akribie und spielerischem Vergnügen zugleich, baut, wenn es gelingt, kleine Pyramiden mit den aussortierten Steinen.
Die Erzählung von Augusts Leben und Arbeiten ist das erste von elf Kapiteln dieses kleinen Büchleins mit knapp 140 Seiten. Ein namenloser Ich-Erzähler erinnert sich an seine Erinnerungen aus Kindheit und Jugend, von Mitte der 1960er Jahre an. Es ist weniger der annoncierte Roman als eine Novellensammlung.
Erzählt, ja: wieder-holt wird eine Kindheit, die tief verwurzelt ist im ländlichen Leben Mitte der 1960er Jahre. Das Jahr war noch bestimmt durch den Wechsel der Jahreszeiten. Die Jahre wurden unterteilt in »vor«, »während« und »nach« dem Krieg. Drei Generationen der Familie mütterlicherseits des Erzählers lebten im Dorf. Es gab Zeiten, als Urgroßmutter, Großmutter und Mutter zusammenarbeiteten, beispielsweise beim Ernten und Einwecken von Obst. Das Kind war entbunden vom Mithelfen, schaute zu, bekam mit etwas Glück einen Kompott nicht verwerteter Früchte.
Ansonsten fuhr es mit dem Fahrrad in die Wälder, bevorzugt alleine, »träumte in das schwere Wolkengeschiebe« hinein und kletterte in den Eichen herum. Der Vater, ein Flüchtling aus Ostpreußen, war stolz, es vom Habenichts zum Kaufmann geschafft zu haben. Großartig, wenn sein »schweigsamer, lächelnder Stolz« wiedererlebt wird. Im Dorf häufte er Ehrenämter an und handwerkelte mit Akribie und Perfektionsanspruch an seinem Haus. Der Schuppen neben der Garage war sein Lieblingsplatz; Werkstatt als Refugium. Unterbrochen wurde das Alltägliche mit Festen. Das Erntefest hatte das Kind lieber als das Schützenfest und als ihm einmal ein Mann, der sich mit seiner Kleidung als jemand »aus einer anderen Welt« zeigte, ein paar Schuss für die Schießbude spendierte, versagte er. Die Pfauenfeder, die man ihm schenkte, wurde verschmäht.
Die Großmutter trug immer ein schwarzes Kleid, nur bei Küchenarbeiten mit einem Kittel geschützt. Als der Junge irgendwann nach dem Großvater fragte, blieben die Reaktionen verhalten. Der derart geheimnisvoll-abwesende Großvater bekam dadurch eine besondere Form von Anwesenheit. Später hieß es, er hätte sich zwei Jahre vor der Geburt der Jungen erschossen und das habe etwas mit dem Krieg und seiner Schwermut zu tun gehabt.
Das Meisterstück in diesem Buch entwickelt sich an einem Tag nach einem Sonnenbrand des Jungen. Es ist gegen Ende des zweiten Schuljahrs. Wie immer nach dem Scheppern der Pausenklingel mussten sich die Kinder in Pärchen-Reihen aufstellen, um geordnet, Hand-in-Hand, wieder zurück ins Gebäude zu gehen. Das Kind wollte gerne rasch zurück, beeilte sich in eine vordere Reihe zu kommen und nahm dafür sogar die Hand eines Mädchens in Kauf. Aufsicht hatte Fräulein E, die kurz zuvor noch mit einer Lord Extra ins »Ungefähre« geschaut hatte. Für ihn war dieses kurze Warten eine Pause nach der Pause, die er genießt. Dann kam E. und stellte sich an der Spitze der Schlange. »Ihre Unterschenkel waren auf der Höhe meiner Augen.« Und nun beginnt eine Blickexkursion des Jungen von den Schienbeinen über die Wadenmuskeln, die er am liebsten berührt hätte, aber das war natürlich nicht statthaft bis zum Saum des Rocks, der ja nach Bewegung Ausblick auf die Knie erlaubten. Am Ende richtete sich das Interesse auf die Füße und besonders auf den großen Zeh der Lehrerin mit einem rosa Nagel (rot war unstatthaft, galt als »nuttig«, wie etwa rote Pumps, die die Mutter so gerne gehabt hätte, aber nie kaufen durfte). Es ist ein einziges Schwärmen und Schwelgen in Zeitraffer erzählt wird und dann ruckartig zu einem Ende kam, als sich die Schlange in Bewegung setzte. Noch einmal konnte er dieses Ereignis am nächsten Tag nachstellen, aber die Intensität, das Großartige dieses Erlebnisses, ließ bereits nach. Schließlich war der Zauber verflogen und nach den Sommerferien hatte sich die Lehrerin verlobt und war zu ihrem künftigen Mann gezogen.
Ja, das alles klingt nach Idylle und das Schlimmste was ihm passiert ist, dass er einmal, als er mit dem Fahrrad die Schuhe seiner Mutter zum Schuster ins Nachbardorf bringt, von Jugendlichen mit einem Auto zum Halten gezwungen wird. Aber irgendwann, in einer kurzen Szene als der Junge ein Gymnasiast ist, wird aus der wohligen Langweile Öde. Vorbei die Freude, die Mutter bei ihren Friedhofsgängen begleiten zu dürfen. Und auch der Enthusiasmus über die schmutzige Christine und ihrem hinreißend erinnerten Schweineritt war ein Relikt der Vergangenheit wie die Schmiede, die plötzlich verschwunden war.
Dass es noch mehr gegeben haben muss, beginnt man zu ahnen, als der inzwischen in Tübingen lebende Sohn quer durch Deutschland reisend seine Mutter in einem Pflegeheim besucht und das Buch für kurze Zeit in der Gegenwart ankommt. Ihre einstige Prophezeiung, sie werde als Pflegefall enden, ist eingetroffen. Und sie tut alles dafür, dass es dabei bleibt, begibt sich in eine »Totalblockade«, denn Therapie- und Bewegungsmaßnahmen nach einer Hüft-OP lehnt sie ab, sie lässt sich lieber bedienen und pflegen, vielleicht eine Art von Kompensation dafür, »daß während der langen Zeit ihres alltäglichen Daseins für andere die Angst in ihr gekeimt und gewachsen war, sie könnte den Zeitpunkt verpassen, selbst einmal rundum gepflegt und versorgt zu werden«. Und diesmal kümmerten sich sogar einmal Männer um sie.
Kurz wird das Leben der Mutter rekapituliert, die Konventionen, denen sie sich gefügt hatte, ihrem Hang zum »Modernen«, wie sie Maschinen nannte, die ihr die Hausarbeit erleichterten. Dann (vermutlich als Witwe) ihre Phase des Lesens von Büchern, die ihr aus dem Fernsehen empfohlen wurden, die Reisen, mit denen sie ihre Bildung verbreiterte. Und am Ende des Buches sitzt man mit dem Erzähler wieder bei der Mutter und die möchte noch einmal vom Sohn erzählt bekommen, wie er einst das Wäldchen angezündet hatte. Er macht das etwas widerwillig und vielleicht, so beginnt man zu denken, versammelt dieses Buch nicht nur die Wieder-Holungen von Erinnerungen, sondern ist auch eine Anthologie von Beschwörungen aus einer vergangenen Zeit für die Mutter.
Trotz zeitlicher und geographischer Unterschiede kommen einem Brunos Erlebnisse aus Wolfdietrich Schnurres Als Vaters Bart noch rot war in den Sinn. Henning Ziebritzki fächert in Brand mit sanfter Lässigkeit und poetischem Realismus unerhörte Begebenheiten des Glücks einer Kindheit auf, die einem bei der Lektüre augenblicksweise ergreifen. Und irgendwann wird man vielleicht noch einmal Genaueres von ihm lesen und ich freue mich bereits jetzt darauf.
