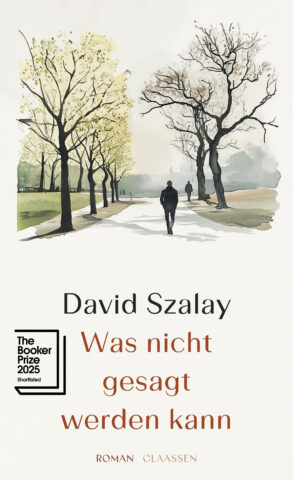
István ist 15 und zieht irgendwann Mitte der 1990er Jahre mit seiner Mutter in eine neue Stadt, vermutlich ein Budapester Randbezirk. In einer Wohnung gegenüber wohnt eine Frau mit ihrem herzkranken Mann. Die Mutter möchte, dass István mit ihr in den Supermarkt geht und die Einkäufe hochträgt. Er fügt sich widerwillig, nichts ahnend, dass hier der Keim für eine Katastrophe liegt.
Aus der Antipathie, die István für die als alt und hässlich empfundene Frau zu Beginn entwickelt (sie soll, wie es einmal heißt, ungefähr so alt sein wie seine Mutter), wird eine Obsession, denn sie führt den pubertierenden Jungen, der unlängst bei einem gleichaltrigen Mädchen eine herbe Abfuhr erhielt, Schritt für Schritt in die Welt der Sexualität ein. Was sie nicht ahnt: István verliebt sich in sie und als sie das Verhältnis beenden möchte, rebelliert er.
So beginnt Was nicht gesagt werden kann, der neueste Roman des 1974 in Kanada geborenen, britisch-ungarischen Autors David Szalay, der auf der Shortlist des Booker-Prize 2025 steht (Originaltitel: Flesh). Es ist der dritte Roman von Szalay, der ins Deutsche übersetzt wurde. Trotz des Verlagswechsels von Hanser nach Claassen wurde auch dieses Buch von Henning Ahrens übersetzt.
Erzählt wird chronologisch aus personaler Sicht nicht weniger als das Leben eines nachnamenlos bleibenden, um 1980 herum in Ungarn geborenen István. Eine besondere Dynamik entsteht dadurch, dass durchgehend im Präsens erzählt wird. Es ist schwierig, dieses Buch zusammenzufassen, ohne die Brüche, die Hoch und Tiefs, die Schicksalsschläge, die István mitunter mit Hilfe von Alkohol und/oder Tabletten mit Phlegma, Passivität und Pragmatismus erlebt und erträgt, vorweg zu nehmen. Die Dialoge in diesem Roman sind minimalistisch; István ist kein Welterklärer, zudem gibt es kaum Kontakte mit Intellektuellen in seinem Leben. Mehr als einhundert Mal sagt er »Okay« und das genügt dann. Obwohl István kein Frauenheld im klassischen Sinn ist und den Beischlaf eher als eine Art Körpervergnügen zu betrachten scheint, spielen Frauen bei ihm eine relevante Rolle.
Einzig der Schritt in die Armee, die Verpflichtung für fünf Jahre, die ihn unter anderem in den Irak führt, geschieht auf eigene Initiative. Ansonsten nutzt István Angebote, hört auf seine Mutter oder hat einfach nur Glück und findet im entscheidenden Moment Mentoren. Über Umwege kommt er so zu vermeintlich großem Reichtum in London. Auch hier spielt eine Frau, die ihm verfällt und über deren optische Unzulänglichkeiten er hinwegsieht, eine entscheidende Rolle.
Der Erzähler bleibt in zehn Kapiteln den entscheidenden Wendungen Istváns vom Armeehelden über den Buchhalter, den Security-Bodyguard bis zum Chauffeur und Kaufmann dicht auf den Fersen. Figuren, die in früheren Lebensabschnitten Istváns Leben kreuzten, erscheinen nie mehr. Die Ausnahme ist die Mutter. Kleine Impressionen abseits der Hauptfigur, beispielsweise über Orte oder subtile allegorische Anspielungen wie etwa »Skulpturen verharren in ihrer Haltung«, muss man suchen. Der lakonische Sound vermittelt einem das Gefühl, István trage ein noch zu entbergendes Geheimnis in sich. Irgendwann gegen Ende scheint er Bilanz zu ziehen: »Ihm kommt der Gedanke, dass er nicht der gute Mensch ist, für den er sich stets gehalten hat. Wahrscheinlich ist er gar kein guter Mensch.« Das sagt er auch einer neuen Liebschaft. Aber die Frau »entgegnet, das stimme nicht.« Bezeichnend für die Figur István ist seine Reaktion darauf, die er für sich behält: »Und ihre Art, das zu sagen, weckt in ihm den Wunsch, ihr noch mehr wehzutun.«
Kurz darauf entwickelt sich jene Geschichte, mit der István ein Vergehen von vor vierzig Jahren auf eine besondere Art sühnt. István weiß nicht, warum er so handelt, aber es überkommt ihm dabei das Gefühl einer Zäsur. Durch dieses Verhalten wird der ambivalente, nicht immer sympathische István plötzlich zu einer im wörtlichen Sinn tragischen Figur. Von Ferne ein literarischer Enkel von Franz Biberkopf.
Die Katharsis beim Leser endet nicht mit der Lektüre. Dieser Lebensweg geht einem so schnell nicht mehr aus dem Kopf. David Szalay hat einen ergreifenden Roman geschrieben.
