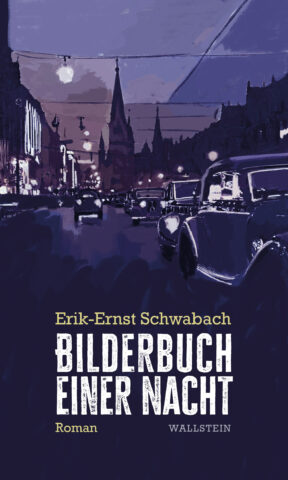
Bilderbuch einer Nacht
Nein, unveröffentlicht im strengen Sinne war der Roman Bilderbuch einer Nacht des deutschen Autors Erik-Ernst Schwabach bisher nicht. Er erschien 1938 in einem kleinen polnischen Verlag – auf polnisch! Schwabach notierte im Londoner Exil in sein Tagebuch: »Sehr komisch, ein Buch von sich in den Händen zu haben...von dem man kein Wort versteht.« Zwei Tage später erlag Schwabach mit 47 Jahren einem Herzinfarkt. Das Manuskript ging mehr als acht Jahrzehnte verschlungene Wege (in den 1950ern wurde es von Rowohlt abgelehnt). Jetzt, 2025, veröffentlicht der Wallstein-Verlag erstmalig in deutscher Sprache Schwabachs Roman. Kundig ergänzt mit einem Nachwort des Literaturwissenschaftlers und Schwabach-Biografen Peter Widlok.
Vielleicht sollte man Widloks Nachwort zuerst lesen. Schwabach wurde in eine wohlhabende jüdische Bankiersfamilie hineingeboren. Er sah sich früh als Künstler, Schriftsteller, verfasste 1913 eine Abhandlung über den Expressionismus, arbeitete bei der Literarischen Welt, gab Zeitschriften heraus, experimentierte mit dem Radio (»Funkspiele«) und betätigte sich als Kunst- und Kulturmäzen. Seine Lesungen und Feste auf dem schlesischen Schloss Märzdorf sollen legendär gewesen sein. Dann der Absturz. Schwabach hatte in Reichsmark investiert, weniger in Immobilien oder Dollar. Die Weltwirtschaftskrise traf ihn hart, er musste seine berühmte Büchersammlung und schließlich auch Märzdorf verkaufen. Schwabach floh 1933 mit seiner Familie nach Großbritannien, hielt sich mit Unterhaltungsstücken und Exposés für Theater und Filmstoffe über Wasser. In Deutschland konnte er nur noch unter Pseudonym veröffentlichen. 1936 begann er mit Bilderbuch einer Nacht.
Schwabachs Episodenbuch beginnt an einem Samstag um 18 Uhr und endet rund zwölf Stunden später. Schauplatz dürfte Berlin sein, obwohl der Name nicht fällt und bekannte Straßen oder Bauwerke nicht genannt werden. Interessant die Datierung, die er vornimmt: »20. Oktober 193.«. Der einzige 20. Oktober, der in den 1930er Jahren ein Freitag ist, findet sich im Jahr 1934. Aber im gesamten Buch gibt es keinen Hinweis auf die Nazi-Regentschaft. Es ist formal ein unpolitisches Buch.
Wer kann, sollte sich ein Personenverzeichnis anlegen, denn viele Protagonisten tauchen in dieser Nacht an unterschiedlichen Örtlichkeiten auf und es ist nachträglich hübsch, wie Schwabach die Aufeinandertreffen gestaltet hat. Da ist etwa der Arzt Dr. Peter Paulsen, der auf ein Dinner bei Bankier Waldherz eingeladen ist, einer großbürgerlichen, reichen Familie. Mit eingeladen ist Ilse, Paulsens Frau, eine ehemalige Kaufhausangestellte, die aus ganz anderen Verhältnissen kommt und von den Honoratioren und Prominenten von oben herab betrachtet wird. Paulsen begegnet beim Dinner Beate Meisner, eine weltgewandte und gebildete Frau, die, wie es einmal heißt, viel verspricht und er scheint ihr zu verfallen, während der Dichter Sven Marken sich für Ilse interessiert. Über all diese Personen hatte der Leser schon vorher einiges erfahren. Spät in der Nacht wird Paulsen in das Krankenhaus gerufen, weil Rudi, der Polizist und Verlobte einer Küchenhilfe der Waldherzens, bei einer Schießerei verletzt wurde.
Das ist nur ein Strang der Verwicklungen der Figuren, die zunächst nichts miteinander zu tun haben, um dann irgendwie in dieser Nacht aufeinander zu treffen und sei es nur für einen vielleicht lebensverändernden Augenblick, bevor sich dann alles wieder zerstreut. Und wie es weitergeht, erklärt der allwissende Erzähler nicht. Es endet alles am Sonntag mit der Dämmerung.
Erik-Ernst Schwabachs kaleidoskopartiges Wimmelbild von vielleicht anderthalb Dutzend Figuren, die sich beispielsweise in einer Boxarena, auf dem Rummelplatz, in einer Skatrunde in der Küche bewegen, ist atmosphärisch dicht erzählt. Ein Höhepunkt ist die Beschreibung der Dinnergesellschaft bei Waldherz, deren Einrichtung, die Etikette, die deutlich machen, das es sich hier um Ausläufer des 19. Jahrhunderts handelt. Demnach also doch ein indirekter politischer Bezug hin zu einer einigermaßen verwirrenden Moderne. Widlok betont zu Recht, dass Bilderbuch einer Nacht zwar an die Großstadtromane der Zeit wie etwa Döblins Berlin Alexanderplatz oder Dos Passos’ Manhattan Transfer Anleihen nimmt, aber dann doch literarisch etwas anderes ist. Er verortet das »Portrait einer Nacht« allerdings ein bisschen verharmlosend in eine neue Sachlichkeit, die ein »modernes Babylon« zeige.
Das greift zu kurz. Bilderbuch einer Nacht ist eben gerade kein »Babylon Berlin«-verkutscherter Gereon-Rath-Klamauk, sondern ein sorgsam durchkomponiertes, mit Erich-Kästner’scher Ironie garnierter, menschenfreundlicher literarischer Abgesang auf eine Epoche. Für uns zeigt es zudem eine Gesellschaft, die (wie übrigens auch sein Autor) noch nichts von den Katastrophen weiß, die ihr bevorstehen. Auch beim schlimmsten Gangster überkommt einem während der Lektüre eine seltsame Rührung. Was wohl aus all den Menschen geworden ist?
Wir kennen nur das Schicksal von Erik-Ernst Schwabach. Eingedenk dessen sollten Literaturfreunde von nun an nicht nur den 16. Juni, sondern auch den 20. Oktober begehen. Dieser Autor, dieser Roman, hätten es verdient.
