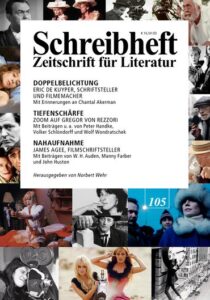
Neues und Altes über und von Gregor von Rezzori
Anlasslos findet sich im neuen Schreibheft von Norbert Wehr unter anderem ein Dossier über den 1998 verstorbenen Gregor von Rezzori, kuratiert von José Aníbal Campos und Jan Wilm. Geboren wurde von Rezzori 1914 in Czernowitz, damals Teil der Habsburger Monarchie. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel die Bukowina vorübergehend an Rumänien, später wurde sie von Stalin einverleibt. Von Rezzori, der fünf Sprachen fließend beherrschte, pendelte zwischen Österreich und Rumänien, strandete schließlich Ende der 1930er Jahre als de facto Staatenloser in Berlin und begann zu schreiben. Zum Ende des Krieges verließ er Berlin nach Schlesien. Von da aus floh er vor den Russen und wurde mit etwas Glück Mitarbeiter des NWDR. In den 1950er Jahren erfand er sein fiktives »Maghrebinien«, ein Phantasieland mit starken Bezügen auf seine ehemalige Heimat und, wie es im Schreibheft heißt, »mitunter pikaresken ironischen Elegien auf ein versunkenes Mitteleuropa«. (Einige Einblicke in dieses Maghrebinien liefert ein Vortrag aus 2017 von Jurij Andruchowytsch ). Wie so oft wurde Erfolg auch Bürde. Seine spätere Prosa nahm man insbesondere im deutschsprachigen Raum nicht besonders ernst. Von Rezzori wurden Images verpasst, Märchenonkel und Lebemann etwa, später dann »Grandseigneur«. Meinte man es gut, nannte man ihn »Epochenverschlepper«, eine Bezeichnung, die er für sich selbst gefunden haben will. Damit sei »das anachronistische Überlappen von Wirklichkeitselementen, die spezifisch einer vergangenen Epoche angehören, in die darauffolgende« gemeint, so seine Definition.
Eine Titelgeschichte im Spiegel in den 1960er Jahren fiel wenig schmeichelhaft für ihn aus und sollte das Bild über ihn viele Jahre bestimmen. Jeder kannte ihn und er kannte jeden; eine Art »Zelig« des Kulturbetriebs. Seit Mitte der 1960er Jahre wohnte er mit seiner dritten Frau in einem von ihm sukzessive renovierten Anwesen in der Toskana. Neben Illustrierten-Artikeln (er selbst nannte es »journalistische Prostitution«), Feuilletons und Romanen schrieb er auch Film-Drehbücher und trat als Gelegenheitsschauspieler auf, obwohl er kein Cineast war. In Viva Maria von Louis Malle etwa als Zauberer. Über die Dreharbeiten in einer fünfmonatigen Zeitkapsel, den Regisseur Louis Malle, die beiden Hauptdarstellerinnen Jeanne Moreau und Brigitte Bardot, die Art und Weise, wie ein Film entsteht und seine Rolle im Intrigenstadel hat er ein launiges Tagebuch geführt, dass zunächst ausschnittweise in drei verschiedenen Medien erschien und dann gesammelt unter dem Titel Die Toten auf ihre Plätze. Literarisch wird es immer dann, wenn er von der Weite Mexikos erzählt, jenes Landes, das er schon zu Beginn zum Balkan Amerikas erklärte.
Das Schreibheft-Dossier liefert neben einem Essay über Leben und Werk Texte von Péter Esterházy und Péter Nádas über ihn, Erklärungen Rezzoris über die Genese seines Schreibens und kommentierte Auszüge aus seinen »Agenden« (meist knappe Tagesbeschreibungen, denen Deutungen zugeschrieben werden). Von Peter Handke werden zwei Briefe an »Grisha« aus 1991 und 1994 publiziert. Im ersten Brief schildert Handke seine Lektüreeindrücke der tatsächlich großartigen Novelle Über dem Kliff. Michael Krüger berichtet von der Wertschätzung von Rezzoris in Czernowitz. Dort wird inzwischen seiner zusammen mit Paul Celan, Rose Ausländer und Aharon Appelfeld gedacht. Weiterhin gibt es Interviews mit Wolf Wondratschek und Volker Schlöndorff. Man erfährt, dass von Rezzori trotz prekärer finanzieller Situationen immer von einer barocken Großzügigkeit war. Wondratschek preist ihn als »erzählerisches Naturtalent« und Volker Schlöndorff sah ihn als bisweilen abgehobenen, sich in seiner Rolle wohlfühlenden, leicht arroganten Außenseiter. Anders von Rezzori, der Schlöndorff schon 1965 im Viva Maria-Tagebuch lobte und auch in Mir auf der Spur von 1997, knapp ein Jahr vor seinem Tod von ihm als »begabt, humorvoll, welteinsichtig« schwärmte.
Das Glanzstück dieser Sammlung sind die Tagebuchauszüge von Rezzoris von April bis Oktober 1943. Er lebte damals mit Frau und zwei Kindern in Berlin (die österreichische Staatsbürgerschaft bekam er erst 1984). Zunächst werden einige Sentenzen thematisch zusammengefasst (»Über das Schreiben«, »Innenleben«, »Historisches«), bevor dann Passagen über den Luftangriff vom 23./24. August 1943 abgedruckt werden. Die haben es tatsächlich in sich, weil sich Rezzori als nüchterner, fast kalter Beobachter zeigt, der sich zuweilen bremsen muss, um nicht seiner »unverhohlenen Sensationslust« zu erliegen. In seiner Autobiographie spricht er rückwirkend sogar von »Schadenfreude«. In den Tagebuchaufzeichnungen entwickelt er in einer Mischung aus Ironie und Zynismus Phänomenologien der Angstbewältigung der Schutzsuchenden in den Kellern und konstatiert, die »Frauen machen sich besser«. Von Rezzori fragt sich, warum es keinen Aufstand gibt, warum dieses »widerspruchslose Ertragen« bei gleichzeitiger Desillusionierung, was die Zukunft angeht. Großartig die Schilderung wie fast unmittelbar nach dem überstandenen Luftangriff in den frischen Ruinen gefeiert und getanzt wird, der Luftschutzwart kocht nachts um 4 Uhr eine Suppe, aber aus dem »Anfang einer Orgie« wird dann doch nur ein »zäher Familientratsch«, obwohl es erotische Signale gibt, die der Tagebuchschreiber gerne aufnimmt. Diese Seiten lohnen sich; ähnliches hat man so noch nie gelesen.
Das Schreibheft hat also Appetit gemacht. Was findet sich auf die Schnelle? Leider ist das sehr schöne Gespräch von Rezzoris mit dem Schweizer Journalisten Heiner Gautschy von 1981 nicht mehr auf Youtube, sondern nur noch auf der Webseite des SRF mit Geoblocker. Gautschy kannte das Werk, fragte wissend, ließ ausreden, nennt ihn einmal den »Hans Christian Andersen des Balkans«, was dieser als Kompliment auffasste. Von Rezzori erklärte sich hier auch, warum er in anderen Ländern zu Ansehen kam, in Deutschland jedoch weniger. Er vermutete, es hing vermutlich mit seiner spöttischen Betrachtung Deutschlands in einer Radioreihe für den NWDR zusammen, die er Idiotenführer durch die deutsche Gesellschaft nannte (später entstanden daraus Bücher). Schließlich, so von Rezzori, werde in der (deutschen) Buchkritik seit längerem nicht mehr das Buch, sondern der Autor kritisiert. Vielleicht stamme es noch aus der Zeit, als die Gesinnung des Schreibers geprüft wurde. Inzwischen werde dessen Moralität bewertet. Das sagte er 1981. Und viel geändert hat sich daran nicht. Eher im Gegenteil.
Die Bücher muss man sich leider inzwischen über Antiquariate besorgen. So manches Kleinod findet sich darunter, vor allem die Novellen. Die bereits angesprochene Autobiographie Mir auf der Spur zeigt die Irrungen und Wirrungen dieser unsteten Persönlichkeit, der erst gegen Ende sesshaft wurde. Bisweilen schlägt die Selbstironie in Pose um. Leicht überflüssig die immer wieder hervorgekramte Abrechnung mit einem Berliner Kultursoziologen und dessen Verunglimpfungen vor mehr als vierzig Jahren. Über die Ironie huscht dann eine Spur Verbitterung. Aber das gehört nicht mehr hierhin.
