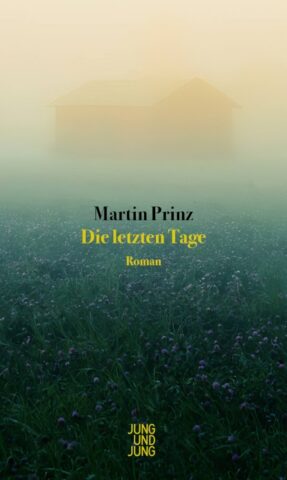
Seit einigen Jahren feiert das dokufiktionale Schreiben eine Renaissance. Schrieben einst William Shakespeare oder Friedrich Schiller ihre Dramen angelehnt an historische Ereignisse, die meist zeitlich weit zurück lagen, so konnte man in der letzten Zeit vermehrt biografisch angelegte Romane etwa über die Naturwissenschaftler Karl-Friedrich Gauß und Alexander Humboldt, den Sinti-Boxer Johann Rukelie Trollmann, den Hellseher Rafael Schermann, die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin, den Aussteiger August Karl Engelhardt, den Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst oder den Religionsprediger Peter Bender lesen (um nur einige zu nennen). Hier werden die Lebensgeschichten mehr oder weniger bekannter, historischer Personen (nach)erzählt. Dichterische Freiheiten sind dabei vorprogrammiert, wie man beispielsweise an Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt und Lichtspiel sehen kann. Hier wird offensiv mit fiktiven Elementen gespielt, wobei das Biografische seiner Protagonisten nur als Gerüst dient. Meist wird jedoch in Dokufiktionen suggeriert, dass das sich Geschilderte so (oder so ähnlich) ereignet hat. Um sich nicht in die drohende Authentizitätsfalle zu begeben, gibt es Bücher, in denen die Namen der realen Personen verfremdet wurden, was narrative Spielräume für den Autor eröffnet.
Dokufiktionale Texte sind in mehrfacher Hinsicht delikat, wie man beispielsweise an Stella von Takis Würger zeigen kann. Würger schreibt im journalistischen Kolportagestil die Geschichte der Jüdin Stella Goldschlag, die im Zweiten Weltkrieg andere Juden an die Nazis verriet. Während die Literaturkritik das Buch überwiegend ästhetisch misslungen fand, avancierte es zum Bestseller, was einzelne Buchhändler veranlasste, die Kritiker zu kritisieren. Die größte Problematik des Autors, der Autorin, besteht darin, nicht überlieferte Einzelheiten, beispielsweise Dialoge oder die Schilderung von (womöglich richtungsweisenden) situativen Befindlichkeiten, erfinden zu müssen, um die Geschichte fortzuschreiben. Hier fließen häufig Wertungen unmittelbar ein. Der Leser kann am Ende nur schwer unterscheiden, welche Stellen des Textes real und welche fiktionalisiert sind. Bisweilen wird versucht, Überlieferung und Fiktion durch die Änderung des Schriftbilds zu kennzeichnen. Generell besteht die Gefahr, dass das Bild einer historischen Figur durch einen dokufiktionalen Text richtungsweisend kanonisiert wird.
Mit diesen Vorbehalten machte ich mich an die Lektüre von Die letzten Tage von Martin Prinz. Der Autor ließ mir Mitte Februar das Buch über den Verlag zukommen. Unmittelbar darauf begannen vor allem in den österreichischen Medien die hymnischen Besprechungen, die ich nur geteasert zur Kenntnis genommen hatte. Endlich fand ich jetzt Muße, den (vermeintlichen) Roman zu lesen.
