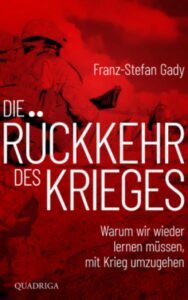
Spätestens seit dem 24. Februar 2022, dem Beginn des Überfall Russlands auf die Ukraine, ist der Krieg, ob man will oder nicht, wieder unmittelbar in Europa präsent. Vergessen die vielen Stellvertreter- und Regionalkriege, die seit Jahrzehnten und auch nach dem vermeintlichen »Ende der Geschichte« auf der Welt tob(t)en. Die sogenannte Friedensdividende ist aufgebraucht. Rückwirkend betrachtet begann das alles schon viel früher. Man wollte jedoch unter anderem aus ökonomischen Gründen die Zeichen der Zeit nicht erkennen und verfiel in einen geopolitischen Dornröschenschlaf. Und immer noch ist vielen der Weckruf derart unangenehm, dass sie darauf bestehen, weiter schlafen zu dürfen. Es sind jene, die mit ihren außenpolitischen Einschätzungen seit je stets falsch gelegen haben.
Zeit also für ein aufklärendes, versachlichendes Werk über das, was wir Krieg nennen. Der österreichisch-amerikanische Militäranalyst Franz-Stefan Gady hat dies mit Die Rückkehr des Krieges versucht. Seine These geht dahin, dass Kriege in Mitteleuropa und damit auch im deutschsprachigen Raum wahrscheinlicher geworden sind. Zitiert wird unter anderem der amerikanische Historiker und Diplomat Philip Zelikow, der die Wahrscheinlichkeit auf 20 bis 30 Prozent für einen weltweiten Krieg »in den kommenden Jahren« angibt. Der militärische Hegemon USA, der bisher als Garant europäischer Sicherheit galt, wird, könnte durch einen drohenden Konflikt mit China um Taiwan im Indopazifik beansprucht werden während gleichzeitig Russland in gezielten kleinen (oder großen) Operationen NATO-Gebiet im Baltikum angreift. Europa muss also im eigenen Interesse militärische Abhängigkeiten von den USA minimieren und auf konventionellem Gebiet abschrecken können.
Gady beschäftigt sich zunächst mit dem »Zeitalter der Fehleinschätzungen«, das irgendwann in den 1990er Jahren begann. Sukzessive verabschiedeten sich die (West-)Europäer beispielsweise von der Möglichkeit im Verteidigungsfall eine »hoch intensive Landkriegsführung« führen zu können. Mit dem Fokus auf neue Technologien vernachlässigte man als veraltet betrachtete Militärtechniken und die Produktion ausreichender Munition. Die Verteidigungshaushalte wurden zusammengestrichen. Man konzentrierte sich auf die Planung regional und zeitlich begrenzter Auslandseinsätze. Eine militärische Abschreckung schien unnötig zu sein. Der sich bereits in der Nachrüstungsdebatte Mitte der 1980er Jahre abzeichnende Pazifismus feierte mit dem Fall der Mauer in einem »postheroischen Weltbild als identitätsstiftendes Ideal« seinen Durchbruch.
