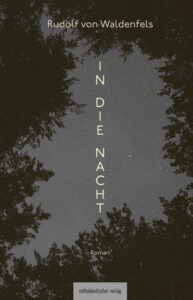
In die Nacht
Ein Mann (Mitte 40/Anfang 50) bekommt die Diagnose Blasenkrebs, und hat, so die Ärzte, vielleicht nur noch ein Jahr zu leben. Die Verzweiflung ist groß, die Welt bricht zusammen. Dann, nach einer Operation, die überraschende Entwarnung: Der Krebs »hatte ein wesentliches Stadium doch noch nicht erreicht«, er kommt »aus der Sache« »mehr oder minder unbeschadet« heraus, ohne Chemotherapie oder Bestrahlung. Ein neues Leben. Und nun?
Robert von Waldenfels zeigt uns den derart dem Tod entronnenen Ich-Erzähler in seinem Roman In die Nacht zunächst als depressiven, lustlosen Tageverplemperer. Vage ist von einer Frau und Kindern die Rede, aber die spielen kaum eine Rolle, es geht um ihn. Welcher Tätigkeit er nachgeht, erfährt man ebenfalls nicht genau; es könnte eine journalistische sein. Vor einigen Jahren hatte er, wie man nebenbei erfährt, eine große Schauspieler-Karriere ausgeschlagen und war für Jahre aus Deutschland verschwunden.
Das alles erfährt man im kaskadischen Gedankenstrom des Erzählers, der zu Beginn in einem heruntergekommenen Gebäude, das vielleicht einst von Grenzern benutzt wurde, aufgewacht ist. Hier ist sein »Refugium jenseits von Raum und Zeit«, das »Haus der vergessenen Träume«. Hier verbringt er immer wieder seine Nächte, in einem Raum, der leicht nach Kot riecht und auch sonst alles andere als einladend beschrieben wird, aber er erfährt eine Art »Heilung«. Und jetzt randalieren auf dem Gelände junge Männer, werfen Flaschen, haben ihn zum Glück nicht entdeckt und der Leser bekommt die ganze Geschichte, nein: die vielen Geschichten erzählt, die ihn nach seiner Apathie zu einem fast obsessiven Nachtgeher werden ließen, der immer wieder aufbrach, auch mit hohem Fieber delirierend oder verstauchtem Fuß herumhumpelnd. Bisweilen unternimmt er stundenlange Zugfahrten, lässt sich treiben, fährt, geht, wandert in und durch die Nacht, kampiert im Zelt im als Kathedrale empfundenen Wald und lässt sein und das Leben anderer Revue passieren.
Es ist die Form, die von Waldenfels für dieses Erzählen findet, die den Leser mitreißt, aber auch eine gesunde Anstrengung verlangt. Gerade noch beobachtete er die Vorgänge um sein Haus, dann die Erinnerung an seine Aufenthalte in New York, als 20jähriger, Opfer eines Raubüberfalls und Jahre später, inzwischen Atheist aus »hochmütiger Genugtuung«, die Besuche in einer afroamerikanischen Kirche eben da, die ekstatische Freude der Teilnehmer, die ihn mit vereinnahmen, wenig später eine großartige Impression vom südlichen Teil des Odenwalds. Zwischendurch eine Lektüre, ein E‑Book über den Opferkult der Azteken, Schilderungen, vom rituellen Töten von 20.000 Menschen in vier Tagen und Nächten, derart gruselig, dass er aufhört zu lesen. Plötzlich eine Szene aus der Kindheit, in der er von seiner Schwester vor dem prügelnden Vater in Schutz genommen wird, hinüber nach Indien und in den Himalaya, schließlich wieder zurück bei der Schwester, die in ihrem Zimmer eine Felsmalerei eines »›Tanzenden Schamanen‹ aus der Trois-Frères-Höhle in Südfrankreich« und ein Lenin-Bild an der Wand hängen hatte. Es entsteht ein großartiges, wehmütiges, ergreifendes Portrait einer Frau, die sich der Kunst unterordnete und dafür bereit war, bis zur Selbstzerstörung alles, inklusive prügelnde Männer, hinzunehmen.
Keine Zeit für Ergriffenheit (die muss man sich als Leser nehmen), denn schon geht es weiter, man dann von dem Herumgehen im Spreewald an einem Januartag, die Welt war »leer geblasen von der eisigen Kälte«, gar nicht so seltene, exzessiv erlebte Glücksmomente, in bisweilen wunderschönen nachtimpressionistischen Bildern und mit der Zeit geht der anfangs ängstliche Erzähler immer vertrauensvoller in die Dunkelheit. Mal ist man in Berlin bei Hamza, einem Syrer, der seit 40 Jahren in Deutschland lebt, über 70 Jahre alt ist, mit zahlreichen Frauen videochattet, deutsche Gedichte auswendig rezitiert und leider nicht besonders ergiebig ist, was sein Nahtoderlebnis bei einem Herzinfarkt angeht, denn außer Schmerzen war da nichts. Mal beginnt er eine Prügelei mit LKW-Fahrern auf einem Parkplatz, entdeckt die Kunst des Überraschungsangriffs, bevor es durch Lehmgelände irgendwo in Sachsen-Anhalt geht und unverhofft die Erinnerung an Susanne einbricht, eine frühere Mitschülerin, der er kurz vor seiner dritten Operation begegnet war. Sie war wie auch immer zu Wohlstand, vielleicht auch Reichtum gekommen, und er erinnert sich an die Susannes Verwandlung, die vom Mauerblümchen mit unmöglichen Klamotten nach einem Selbstmordversuch plötzlich durchstartete und Schülersprecherin wurde. Er wird mit ihr nach Besichtigung des von ihr erworbenen Landhauses schlafen. Immer mehr Lehm sammelt sich unter seinen Schuhen, es ist der Drang nach vorne und dann fällt der eine Satz, unverhofft, unpassend, schneidend: »Ein Jahr nach unserer Begegnung nahm sich Susanne das Leben.«
Ineinandergreifendes Erzählen, über- und nebeneinander gestapelt wie Kartons, die zwar geöffnet werden, aber deren Inhalt sich erst nach und nach erschließt, manchmal auch gar nicht. Dieses Verfahren wird nur zwei Mal für drei bzw. sieben Seiten unterbrochen. Beim Auffächern der Verwandten verbleibt der Erzähler am Ende beim Großvater väterlicherseits und zitiert aus dessen Aufzeichnungen. Zunächst ist es eine Tagebucheintragung von 1932 über den Besuch einer Versammlung mit Adolf Hitler. Er, der Großvater (»A. v. W.«), sitzt widerwillig dort, kann mit dem »vulgären Emporkömmling« nichts anfangen. Er ist weniger als zwanzig Meter von ihm entfernt und schockiert, dass dieser hässliche, linkische Mann womöglich demnächst die Geschicke des Reiches bestimmen könnte. Dann legt dieser mit seiner Rede los. Und alles verändert sich. Er wird wie auch immer in den Bann gezogen und schließlich Parteigänger der Nazis, später, in bereits höherem Alter, sogar Pilot und vollbringt einige »Heldentaten«.
Fast noch skurriler ist die zweite Binnenerzählung. Der Großvater plante für die Zeit nach dem Krieg, seine Erlebnisse als Buch zu publizieren. Abgedruckt wird ein Text von ihm, in dem auktorial über einen Piloten erzählt wird, der am 15. Juli 1943 abgeschossen wurde und der mit seiner Maschine »hinter den sowjetischen Linien« aufkam. Haarklein und in allen Details wird geschildert, wie dieser Pilot, ein Major, dem Tod unumkehrbar näher kommt, die nachlassenden Körper- und Organfunktionen miterlebt, ohne einschreiten zu können. Verstörend daran ist, dass vorher behauptet wurde, der Großvater sei exakt am 15. Juli 1943 abgeschossen worden. Die Maschine soll allerdings, so heißt es, noch der Luft explodiert sein. Die sich ergebenden Fragen bleiben unbeantwortet. Hatte der Großvater seinen Todestag vorweggenommen? Oder ist der Erzähler unzuverlässig? Letzteres wird bisweilen suggeriert, weil nicht immer klar ist, ob es sich um eine Erscheinung, einen Traum oder Realität handelt.
Ein realistischer Erzähler ist hier nicht am Werk; dies gilt es zu akzeptieren. Dann fragt man auch nicht nach autobiographischen Übereinstimmungen zwischen dem Ich und dem Autor, auch wenn sie, was die Erkrankung angeht, zutreffen mag. Es ist am Ende unerheblich, ob der Erzähler da und dort war, diesen Laden besucht hat oder nicht. Dem Leser bleibt nur eine Aufgabe: Sich dem Sog dieser Eindrücke von Nacht, Dämmerung, Blitz, Donner, Kälte, Ungewissheit und Mondlicht hinzugeben. Dann kann das geschehen, was dem Erzähler im Idealfall passiert: ein »rauschartiger Zustand«.

Danke für Ihren wunderbaren Kommentar zu Rudolf von Waldenfels’ !