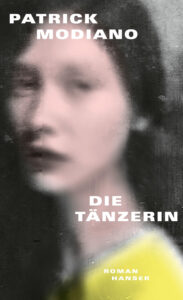
Die Tänzerin
Unlängst feierte der französische Schriftsteller Patrick Modiano seinen 80. Geburtstag. Seit Mitte der 1970er Jahren werden seine Bücher in Deutschland publiziert – in mehreren Verlagen und von einigen Übersetzern, unter anderem auch Peter Handke, der zeitweise die Modiano-Bücher nach Suhrkamp brachte, bevor sie bei Hanser und Übersetzerin Elisabeth Edl eine Heimstatt bekommen haben. Mit den Jahrzehnten sind seine Romane zu kleinen, luftig-duftigen Erzählungen geworden, die um Erinnerung, Zäsuren und gescheiterte (oder gelungene) Lebensentwürfe kreisen. Auch im neuen Roman Die Tänzerin (wie gehabt übersetzt von Elisabeth Edl) spielt die Erinnerung und deren Unzuverlässigkeit eine wichtige, eigentlich die entscheidende Rolle. Zeit und Bilder verwischen, aber gerade hierin scheint der Reiz zu liegen, der weniger darin besteht, sich präzise zu erinnern, sondern trotz oder gerade mit den bruchstückhaften Bildern so etwas wie eine »ewige Gegenwart« zu erzeugen, wie es fast euphorisch am Ende des Buches heißt.
Es beginnt mit einem Mann, den der Ich-Erzähler zwischen all den Touristen-»Horden« in Paris zu entdecken glaubt: seinen ehemaligen Vermieter von vor 50 (oder mehr) Jahren. Leider kann sich der derart angesprochene Mann weder an ihn noch an die vorgebrachten Ereignisse erinnern, gibt ihm aber einen Zettel mit Telefonnummern und Adresse.
Ab jetzt läuft die Bildermaschine. Anfang der 1970er Jahre, der Erzähler war Chansontexter, machte er die Bekanntschaft einer Frau, die stets die Tänzerin genannt wird. Sie nahm Ballettunterricht im Studio Wacker, eigentlich ein »verlottertes« Gebäude, aber die Schule hatte einen großen Klang. Lehrer war der Exil-Russe Boris Kniaseff, dessen Methoden und Motivationen berühmt waren. Die Tänzerin hatte einen damals sieben‑, achtjährigen Sohn Pierre und da ist der Flash, als Pierre aus Biarritz mit dem Zug ankam und von seiner Mutter, dem Erzähler und Hovine, mit dem die Tänzerin zusammenlebte, begrüßt wurde. Da war die Scheu zwischen Mutter und Sohn, seine Schüchternheit, die vermutlich ersten Eindrücke Pierres von Paris. Die Trennung von der Mutter »musste lang gewesen sein«, denn, so heißt es in typischer Modiano-Lakonik, »sie wusste nicht, was sie ihm sagen sollte.«
Der Unterricht, das Ballett, war für die Tänzerin ein neues Leben, eine Wiedergeburt, oder, besser: überhaupt eine Geburt. Sie hatte sich dem Ballett verschrieben. »Durch den Tanz hatte sie alles vergessen.« Aber die Zeit wurde getrübt durch Nachstellungen von zwei Brüdern, die Fragen nach dem Vorleben der Tänzerin aufkommen ließen. Sie öffnete sich schließlich dem Vermieter, der die Gespenster der Belästigungen irgendwie abschaffte.
Irgendwann zog der Erzähler in die Wohnung, zur Tänzerin und Pierre. Aber dass man sich angefreundet hatte, wäre übertrieben. Es war ein Miteinander-Leben, sie strukturierten den Alltag. Fragen waren »sinnlos«, wurden nicht gestellt; man wartete darauf, dass man sich dem anderen öffnete. Mal geschah es, mal nicht. Wenn beispielsweise von den Kinogängen des Protagonisten mit Pierre die Rede ist, wird vor allem das gemeinsame Schweigen hervorgehoben. Modiano erzählt genau das wunderbar.
Die Tänzerin trat auch auf, begann ein Verhältnis mit einem Tänzer, aber nur bis zur Premiere. Der Erzähler bekam einen Auftrag eines skurrilen Verlegers. Er sollte ein englisches Buch übersetzen und ihm einige Kapitel hinzufügen. Es war sein erster Kontakt mit Literatur. Er versuchte, den Kunstwillen der Tänzerin auf seinen Literaturenthusiasmus zu übertragen.
So unscharf die Erinnerungen sind, so diffus das Ende. Der Erzähler wüsste gerne, was aus Pierre geworden ist, aber er kennt seinen Nachnamen nicht. Auch von den Tänzerin erfährt man nichts weiter; Kniaseff, der tatsächlich existierende Ballettlehrer, verstarb 1975. Aber das ist alles nicht wichtig, bekennt der Erzähler am 8. Januar 2023, mehr als 50 Jahre nach den Geschehnissen. Die ewige Gegenwart beschert ihm die immer abrufbare Erinnerung an die Christnacht mit Pierre und der Tänzerin.
Wie immer spielt auch die Topographie von Paris eine Rolle. Der Erzähler hadert mit der Entwicklung der Stadt, sie ist ihm fremd geworden. Formal handelt der kleine, szenisch angelegte Roman von Erinnerung, von Zeiten, die nicht materiell, aber menschlich berührend waren. Und es ist eine Geschichte einer unerfüllten, uneingestandenen Liebe. Wie Modiano in diesen wenigen, skizzenhaften Episoden derart wuchtige, anrührende Evokationen herbeiphantasieren kann, die für alle Zeiten Geltung beanspruchen – das ist die große Kunst eines großen Dichters.
