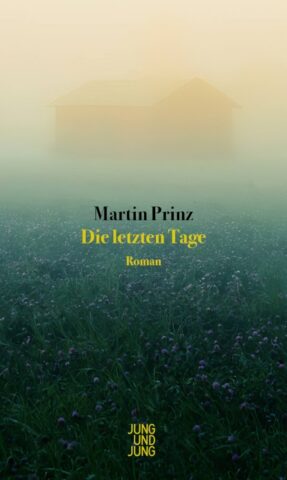
Seit einigen Jahren feiert das dokufiktionale Schreiben eine Renaissance. Schrieben einst William Shakespeare oder Friedrich Schiller ihre Dramen angelehnt an historische Ereignisse, die meist zeitlich weit zurück lagen, so konnte man in der letzten Zeit vermehrt biografisch angelegte Romane etwa über die Naturwissenschaftler Karl-Friedrich Gauß und Alexander Humboldt, den Sinti-Boxer Johann Rukelie Trollmann, den Hellseher Rafael Schermann, die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin, den Aussteiger August Karl Engelhardt, den Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst oder den Religionsprediger Peter Bender lesen (um nur einige zu nennen). Hier werden die Lebensgeschichten mehr oder weniger bekannter, historischer Personen (nach)erzählt. Dichterische Freiheiten sind dabei vorprogrammiert, wie man beispielsweise an Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt und Lichtspiel sehen kann. Hier wird offensiv mit fiktiven Elementen gespielt, wobei das Biografische seiner Protagonisten nur als Gerüst dient. Meist wird jedoch in Dokufiktionen suggeriert, dass das sich Geschilderte so (oder so ähnlich) ereignet hat. Um sich nicht in die drohende Authentizitätsfalle zu begeben, gibt es Bücher, in denen die Namen der realen Personen verfremdet wurden, was narrative Spielräume für den Autor eröffnet.
Dokufiktionale Texte sind in mehrfacher Hinsicht delikat, wie man beispielsweise an Stella von Takis Würger zeigen kann. Würger schreibt im journalistischen Kolportagestil die Geschichte der Jüdin Stella Goldschlag, die im Zweiten Weltkrieg andere Juden an die Nazis verriet. Während die Literaturkritik das Buch überwiegend ästhetisch misslungen fand, avancierte es zum Bestseller, was einzelne Buchhändler veranlasste, die Kritiker zu kritisieren. Die größte Problematik des Autors, der Autorin, besteht darin, nicht überlieferte Einzelheiten, beispielsweise Dialoge oder die Schilderung von (womöglich richtungsweisenden) situativen Befindlichkeiten, erfinden zu müssen, um die Geschichte fortzuschreiben. Hier fließen häufig Wertungen unmittelbar ein. Der Leser kann am Ende nur schwer unterscheiden, welche Stellen des Textes real und welche fiktionalisiert sind. Bisweilen wird versucht, Überlieferung und Fiktion durch die Änderung des Schriftbilds zu kennzeichnen. Generell besteht die Gefahr, dass das Bild einer historischen Figur durch einen dokufiktionalen Text richtungsweisend kanonisiert wird.
Mit diesen Vorbehalten machte ich mich an die Lektüre von Die letzten Tage von Martin Prinz. Der Autor ließ mir Mitte Februar das Buch über den Verlag zukommen. Unmittelbar darauf begannen vor allem in den österreichischen Medien die hymnischen Besprechungen, die ich nur geteasert zur Kenntnis genommen hatte. Endlich fand ich jetzt Muße, den (vermeintlichen) Roman zu lesen.
Martin Prinz schildert in einem kurzen Nachwort den Weg, den der »Stoff« bis zu ihm genommen hatte. Zunächst verfasste ein gewisser Dr. Alois Kermer basierend auf seinen 1993 begonnenen Nachforschungen ein Manuskript, welches sich mit der Geschichte der Kurgemeinde Reichenau während der Zeit des Nationalsozialismus befasste. Kermer hatte festgestellt, dass die Heimatbücher für die Nazi-Zeit eine Leerstelle auswiesen und man beauftragte ihn mit der Aufarbeitung. Er sichtete »Akten und Protokolle, er forschte nach Lebensdaten, Zeitzeugen, befragt Überlebende und Nachkommen der Toten« und »glich Dokumente aus Aussagen« ab, in dem er die Prozessakten ab 1945 auswertete. Kermer war 1944 Jurist am Landratsamt Neunkirchen und kannte einige der Protagonisten. Kranksheitsbedingt war er nicht direkt in die geschilderten Vorgänge involviert, diente jedoch nach dem Krieg als Zeuge vor Gericht und wurde zu den Angeklagten befragt. Das Ergebnis seiner Recherchen ließ der damals 89jährige der Gemeinde 2002 unter dem Titel Erinnerungen an Reichenau a. d. Rax in schwerster Zeit zukommen. Die Reaktion war erwartbar: Mit einer Publikation war nicht zu rechnen.
Immerhin sicherte sich der Standesamtsleiter Hermann Scherzer kurz vor Kermers Tod 2006 eine Kopie des Typoskripts, das er schließlich 2014 an Martin Prinz übergab. Als dieser sich dem Stoff endlich widmen wollte, wurde er durch eine Diplomarbeit von Martin Zellhofer aus dem Jahr 2008 aufmerksam, der Volksgerichtsprozesse dreier Angeklagter ab 1947 thematisierte. Prinz ging nun selber ins Archiv, um die Gerichtsakten zu sichten und auszuwerten.
Der größte Teil von Die letzten Tage besteht in der Kompilation der Recherchen des bis heute unveröffentlichten Kermer-Manuskripts und den Prozessakten der Jahre 1947 und 1948 gegen »Kreisleiter« Johann Braun (*1896), »SA-Standartenführer« Josef Weninger (*1899) und »HJ-Oberbannführer« Johann Wallner (*1909).
Braun erhielt im April 1945 den Auftrag für den Kreis Neunkirchen (Niederösterreich) ein Standgericht einzusetzen. Die von den Nazis hierzu vorgesehenen juristischen Grundvoraussetzungen (ein Richter, ein Staatsanwalt) waren jedoch aufgrund der Kriegssituation (die Russen rückten langsam, aber stetig vor) nicht gegeben. Braun und seine Kumpane interessierte dies nicht. Das Standgericht diente als Machtinstrument. Es kam zu Verhaftungen von schon länger als unliebsam empfundenen Personen mit erfundenen oder aufgebauschten, auf Denunziationen basierenden »Delikten« wie politische Unzuverlässigkeit, Spionage oder »Desertion«, weil sich zum Beispiel jemand nach einer Krankmeldung nicht zurück gemeldet hatte. Der bloße Verdacht genügte. Braun, Wallner der Weninger gebärdeten sich als Richter, Ankläger und »Verteidiger«, teilweise in Personalunion.
Dabei wurden die Verhafteten zunächst häufig in trügerischer Sicherheit gewiegt. Sie kämen bald frei, wurde ihnen suggeriert, das sei alles ein Irrtum. Aber dann erfolgte die Willkür, der Terror. Die »Vergehen« waren lächerlich, an den Haaren herbeigezogen und im Prozess klingt an, dass mit dem »Standgericht« endlich eine Möglichkeit gefunden wurde, mit bestimmten Personen abzurechnen und sich gegebenenfalls deren (Immobilien-)Besitz anzueignen. In den letzten Tagen des Regimes wurden von Braun, Weninger, Wallner und seinen Helfershelfern, die Gosch, Irschik, Langecker, Nowotny, Pauspertl, Steinmetz oder wie auch immer hießen und die fanatisierte 16–17jährige HJler kommandierten folgende Personen ermordet: Maria Czuba, Johanna Eggl, Anna Fischer, Anna Frindt, Maria Habietinek, Wenzel Hofmann, Ladislaus Hrozek, Maria Karasek, Roman Kneissl, Perlja Koch, Maria Landskorn, Johann und Maria Reifböck, Herr Schranz, Ignaz Sommer, Alfons Sterk, Dr. Josef Thaller, Elisabeth und Olga Waissnix, Maria und Oskar Wammerl, Theresia Weizbauer.
Martin Prinz berichtet, nein: er erzählt, von den Schicksalen dieser Personen und setzt ihnen ein Denkmal. Die Art und Weise wie hier erzählt wird, ist von einer derart außergewöhnlichen Intensität, das man während der Lektüre gebannt alle Zeit und alles Drumherum vergisst. Die Aussagen der Angeklagten und Zeugen und die Einlassungen des jeweiligen Richters bei den Prozessen werden je nach Opfer zusammengestellt. Prinz stellt dabei geradezu exzessiv den insbesondere von den Angeklagten, aber auch von zahlreichen Zeugen, die befürchten mussten, durch ihre Verstrickungen ebenfalls angeklagt zu werden, vorgebrachten Konjunktiv in den Vordergrund. Es ist die Sprache des Gerüchts, des scheinbaren Wissens oder Unwissens, der Lüge, des Abwiegelns. Sie schieben Erinnerungslücken vor, müssen, wenn sie der Lüge überführt werden, zurückrudern. Zugegeben wird nur das nicht mehr zu Leugnende. Natürlich werden auch »Unbekannte« ins Feld geführt, irgendwelche SS-Männer, die man vorher und nachher nie gesehen hatte. Jeder Winkelzug wird versucht. Bisweilen streut der Erzähler die Nachfragen des jeweiligen Richters ein und moniert aktiv, warum man in diesem oder jenem Punkt nicht nachgefragt habe.
Es ist paradoxerweise dieser Thomas Bernhard-hafte Kalkwerk-Konjunktiv, der einen enormen Lesesog erzeugt und aufrecht erhält – trotz der Scheußlichkeiten, die zum Teil detailliert ausgebreitet werden. Zwischen den aufgearbeiteten Dokumenten streut der Erzähler immer wieder literarische Imaginationen ein. Etwa letzte Augenblicke derjenigen, die plötzlich wissen, dass sie verloren sind. Oder Opfer werden direkt angeredet. Das ist besonders berührend beim Schicksal des 17jährigen Roman Kneissl, der feige erschossen wird, als er dem Wahnsinn nahe in Todesangst einfach weglief. Gegen Ende versucht sich er Erzähler in die Alois Kermer hinzudenken.
Prinz hütet sich als Erzähler, die Taten zusätzlich zu kommentieren. Die Erzählungen sprechen für sich. Auch wenn andere Verbrecher verurteilt und (entgegen damals geltendem Recht) nach wenigen Jahren bereits vorzeitig entlassen und in die Gesellschaft aufgenommen werden, als wäre nichts gewesen, bleibt es beim Berichtston. Nur wenn es darum geht, dass den Opfern nicht einmal eine Erinnerungstafel zugestanden wurde, schwingt plötzlich Empörung mit.
Besonders detailliert wurde die Ermordung von Ignaz Sommer verhandelt, der mit einer russischen Armbinde mit der Aufschrift »Polizei« aufgegriffen worden war. Alleine die Art und Weise der Verhaftung und Überstellung an das Standgericht wird von mehreren Zeugen unterschiedlich dargestellt. Im Gegensatz zu den meisten Verurteilten sollte Sommer nicht erschossen, sondern erhängt werden. In der Verhandlung wurde nun versucht, den Ablauf der Hinrichtung zweifelsfrei festzustellen, weil etliche Zeugen logen oder sich in Erinnerungsnot flüchteten. Als man vor Ort festzustellen glaubte, dass Ignaz Sommer noch nicht tot war, schoss ihm »Kreisorganisationsleiter« Roman Gosch (*1916) in den Kopf. Es wurde für den Prozess ein Gutachter bestellt, der aufgrund der (zum Teil widersprüchlichen) Zeugenaussagen über die Art und Weise der Hinrichtungsanlage feststellen wollte, ob Ignaz Sommer bereits tot gewesen war, als er den Schuss erhielt. Ansonsten wäre es Mord gewesen. Schließlich war es der Staatsanwalt, der Gosch nur der »Leichenschändung« für schuldig fand, was nach den Einlassungen der anderen Zeugen und des Gutachters zuvor höchst merkwürdig anmutet. Gosch wurde schließlich zu lebenslangem »Kerker« verurteilt, wurde jedoch 1953 begnadigt.
Eine Sonderstellung nimmt der Polizist Heinrich Spielbichler ein, der zwar NSDAP-Mitglied wurde, um Polizist bleiben zu können, aber sich immer als Sozialdemokrat sah. Ende März 1945 brachte er seine Familie vor den herankommenden Russen in Schwarzau in Sicherheit. Als er zu seinem Heimatort Gloggnitz zurückkehren wollte, waren dort bereits die Russen. Er zog die Uniform aus, ging zurück nach Schwarzau und meldete sich dort auf der Gendarmerie, wo man ihm eine neue Uniform aushändigte. Er erregte aber Misstrauen, weil er in Zivil angekommen war. Schließlich kam er in die Standgericht-Mühle, galt zeitweilig als Fahnenflüchtiger. Nach längerer Beratung zwang man ihn zunächst bei der Exekution anderer Todesurteile dabei zu sein. Er will vorbeigeschossen haben. Wäre es nach Wallner und Weninger gegangen, wäre er auch hingerichtet worden. Braun setzte sich jedoch durch und man schickte ihn an die Front. Spielbichler schrieb nach den Ereignissen Gedächtnisprotokolle und es wird hieraus ausgiebig zitiert. Der Überlebensinstinkt half ihm – widerwillig musste er kurz gegen die Russen kämpfen, aber mehrere Erkrankungen und schließlich eine kühne Flucht retteten ihn.
Paul Klamer (*1906), der bei Prinz gemäß den Prozessakten und Kermers Bericht »Klammer« genannt wird, und Franz Plechard (*1903) waren formal Vorgesetzte der drei Angeklagten. Sie entzogen sich 1945 bzw. 1946 durch Freitod ihrer Strafe. Am 24. Mai 1947 wurden Braun, Wallner und Weninger zum Tode verurteilt. Am 14. Mai 1948 wurden die drei über die Abweisung ihrer Wiederaufnahmeverfahren informiert. Gleichzeitig legte man den 15. Mai 1948, 6 Uhr früh, als Hinrichtungstermin fest Prinz zitiert nun ausgiebig die Anträge der jeweiligen Verteidiger. Diese beziehen sich darauf, dass ursprünglich der 12. Mai als »Exekutionsvollzug« vorgesehen war und mir Rücksicht auf die Wiederaufnahmeanträge ausgesetzt wurde. Die neuerliche Ansetzung sei gleichbedeutend mit einer nicht zulässigen »Verschärfung der über den Angeklagten verhängten Todesstrafe«. Es ist sogar von »seelischen Qualen« die Rede, denen sie ausgesetzt seien, nun zum zweiten Mal die Vorbereitungen für die Exekution über sich ergehen lassen zu müssen. Ergänzend wird noch angefügt, dass es sich bei dem 15. Mai um einen »kirchlichen Festtag« handele (»Vigil von Pfingsten«). Braun ergänzte das Schreiben seines Verteidigers sogar handschriftlich um die Bitte um Gnade. Auch Wallner und Weninger reichten noch Gnadengesuche ein.
Schließlich wird die Beschluss des Gerichts vom 15. Mai 1948, 5.30 Uhr, abgedruckt. Alle verwarfen die vorgebrachten Punkte der Verteidigung, wie es heißt: »einhellig«. Der 15. Mai wird zudem als zulässig angesehen, es sei ein »Festtag« aber kein »gebotener Feiertag«, an »welchem der Besuch der hl. Messe vorgeschrieben und die Verrichtung knechtlicher Arbeiten verboten ist.« Ich gestehe, dass ich die Verkündung über den »Eintritt des Todes« der drei Mörder mit großer Befriedigung gelesen habe.
Mit Die letzten Tage zeigt Martin Prinz, wie es möglich ist, Dokumentation mit literarischer Ambition kunstvoll zu vereinen, ohne in triviale Muster zu verfallen. Ergriffenheit, Wut und Empörung werden nicht dekretiert, sondern entstehen beim Leser aus der Gegenüberstellung der Fakten mit den sparsam eingesetzten literarisierten Beschwörungen der Opfer. Der Fokus liegt zwar weiterhin auf die Täter, aber die Opfer werden nicht zu bloßen »Fällen«, sondern erhalten ein Leben.
Klaus Kastberger entdeckt in seiner Besprechung Parallelen zu Heimrad Bäcker und Walter Kempowskis Echolot-Projekt. Letzteres ist jedoch eine reine Textsammlung ohne literarische »Eingriffe«. Kempowskis Kunst bestand in der Komposition der Setzung der jeweiligen Texte. Die einzig kritische Stimme, die zu Die letzten Tage auffindbar war, stammt von Jörg Magenau, der mit der Aussage zitiert wird, das Buch bestünde aus reiner Aktenlektüre und sei dementsprechend »langweilig«. Interessant die Volte, Prinz’ Buch mit Peter Weiss’ Ermittlungen zu vergleichen, um daraufhin zu konstatieren, dass es nicht an Weiss heranreiche. Der Vergleich scheint jedoch unangebracht, da es sich um grundlegend divergierende ästhetische Projekte handelt. (Besonders pikant dabei: Noch heute, in den Nachdrucken beim Suhrkamp-Verlag, wird eine Nachbetrachtung der Aufführung des Stückes in »Westberlin« von Walter Jens abgedruckt, von dem in den 2000er Jahren bekannt geworden war, NSDAP-Mitglied gewesen zu sein.)
Zwei Fragen bleiben: Bekommt das Buch am 10. November den Österreichischen Buchpreis? Und, interessanter: Warum ist die Webseite nachkriegsjustiz.at dauerhaft (Stand: 25.10.2025) nicht erreichbar? Beides wären/sind Symbole. Und jetzt schweigt der Deutsche.
