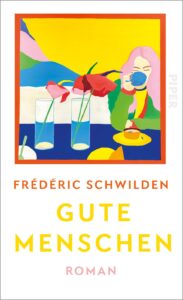
Gute Menschen
Frédéric Schwilden ist Reporter und Kolumnist bei der Welt. Auf X postet er unter @totalreporter. Manchmal sieht man ihn dort, wenn er unterwegs ist, im Zug, in atemberaubend bunten Sakkos. Vor einigen Wochen erschien eine großartige Intervention zu Depressionen und dem Brief von Wolfgang Grupp nach dessen Suizid-Versuch. Davor las ich seine Besuchsberichte bei Rainer Langhans und Uwe Tellkamp. Schwilden ist neugierig und überlässt dem Leser das Urteilen; ein Reporter im altmodischen Sinn. Jetzt legt er mit Gute Menschen seinen zweiten Roman vor.
Er handelt von Jan und Jennifer. Beide sind 1988 geboren, verheiratet und leben in München. Sie ist Partnerin einer Kartellrechtskanzlei (daher der Ehevertrag), er Gymnasiallehrer. Gute Menschen beginnt mit dem Auszug von Jennifer aus der gemeinsamen Wohnung. Es ist der 18. Dezember 2023. Jan ist bei der Großmutter in Krefeld. Jennifers Habe füllt ein V‑Klasse-Taxi zur Hälfte. Sie hat ihre Kanzleianteile verkauft, hinzu kommt ein Erbe. 1,5 Millionen Euro hat sie auf dem Konto. Sie lässt sich zu ihrer neuen 144 m² großen Wohnung fahren. Der La Chaise von Eames wird geliefert; mehr als 8.000 Euro. Die anderen Möbel kommen in den nächsten Tagen. Sie hat Jan einen Brief geschrieben und in den Briefkasten geworfen. Sie beendet die Ehe. Man stritt über Geld. Geld, das man hatte. Man stritt darüber, wie man es ausgibt. »Ich will raus« schreibt sie. Will seine Freundin bleiben. Die eheliche Wohnung überlässt sie ihm.
Die Perspektiven zwischen Jennifer und Jan wechseln bis zum 31. Dezember 2023 hin und her (mit einer Ausnahme: die Erzählung einer Reise nach Texas einige Jahre zuvor). Die Unvereinbarkeit der beiden Lebensentwürfe wird immer deutlicher. Jan ist Heinrich-Böll-Adept, Ansichten eines Clowns und Die verlorene Ehre der Katharina Blum sind für ihn nach wie vor die wichtigsten Bücher. Er hört Drei-Fragezeichen-Hörspiele und glaubt, was in taz und Spiegel steht. Jans Vater war in jungen Jahren an einem Start-up beteiligt, das später zu einem der führenden IT-Unternehmen in Deutschland wurde. Er stieg vorher aus und wurde Lehrer. Idealismus statt Geld. Und dann, später: Neid und Scham; Jähzorn. Und dann starben Jans Eltern bei einem Verkehrsunfall. Jan fühlte wohl eine Art Berufung in sich und wurde wie sein Vater Lehrer. Jennifer liebte ihn, obwohl er »anstrengend« war, glaubte, dass Widersprüche »eine gute Mischung« ergäben. Irgendwann empfand sie nur noch ein Korsett aus Idealismus. Sie resigniert, will leben, ist aber klug genug, die Schicki-Micki-Champagner-Gesellschaft zu durchschauen. Sie braucht nichts davon. Aber sie will es.
Ihre beste Freundin Anne ist mit Kadir, einem älteren, zu Wohlstand gekommenen Geschäftsmann verheiratet. Sie wünscht sich ein Kind; die beiden fast schon erwachsenen Stiefkinder genügen ihr nicht. Am 22. Dezember fliegen die Freundinnen nach Paris. Upgrade vom günstigen Hotel auf das Ritz. Hier sieht sie »die Traurigen« beim Le Grand Brunch. Die Freundinnen schlendern durch Paris, reden über Joko Winterscheidt und andere peinliche Deutsche, »aßen Petit Fours in einem Café, und am Abend gingen sie in die Brasserie Lipp«, sprachen über ihre Drogenerfahrungen. Sie sind albern und frei.
Jan ist indes am Boden zerstört und sucht Trost im Irischen Tagebuch. Die Idee, Jennifer zu kontaktieren, verwirft er; mit Konflikten kann er nicht umgehen. Lieber denkt er an sein bisher nicht zustande gekommenes Buch über den Flugpionier Gustav Weißkopf, der in »vorschuldiger« Zeit lebte und den niemand kennt, obwohl er doch ein Flugpionier war und vor den Gebrüdern Wright das erste Motorflugzeug gebaut hatte. Jans Freund Ümit meldet sich konspirativ. Er wähnt sich verfolgt, weil er brisantes Material über den bayerischen Ministerpräsidenten hat. Jan kennt Ümit, nimmt ihn nicht ernst. Aber er bekommt Zweifel, wenn er die Nachrichten hört. Warum wird jemand strafrechtlich verfolgt, der einen Politiker »Schwachkopf« nennt? Wieso verklagt eine sich liberal nennende Politikerin in Serie Menschen, weil sie sich beleidigt fühlt? Warum wird es zugelassen, dass in Deutschland wieder gegen Juden demonstriert wird? Und ist er nicht zu verständnisvoll, was die »fragwürdigen Ansichten« seiner Schüler angeht? Jan weiß alles über die toten Juden. Aber nichts über die Lebenden.
Seiner Großmutter verschweigt er Jennifers Auszug und kündigt seinen Besuch zum zweiten Weihnachtsfeiertag an. Aber dann bekommt er nachts heftige Brustschmerzen. Er denkt an einen Herzinfarkt. Den Rettungsdienst nimmt er nicht in Anspruch, sondern schleppt sich mit einem Roller zum Krankenhaus und denkt, als er in die Elsässer Straße einbiegt, an Jürgen Elsässer und (warum auch immer) Sahra Wagenknecht. Dann macht er Bekanntschaft mit dem Gesundheitssystem und zynischen Ärzten, die ihn zunächst für einen Simulanten halten. Nach der Operation berichtet man, mehr als einen Liter einer »dicklichen weißlichen Flüssigkeit mit einzelnen roten Sprenkeln« aus seiner Lunge geholt zu haben. »Rekord dieses Jahr«, heißt es. Im Zimmer liegt er zusammen mit einem migrantisch aussehenden Mann. Er grüßt ihn auf türkisch. Bis er dann mit Helmut Bekanntschaft macht, den Sohn des Patienten. Der ist Grieche und sein Vater nannte ihn nach Helmut Schmidt, weil der Griechenland in die EG gebracht hatte. Helmut fragt Jan nach seinem Namen. »Das tut mir leid«, sagt er dann, »dein Name ist so egal.«
Während Jan über Weihnachten im Krankenhaus liegt (und sich einmal mehr selbstquälerisch als lustvoll zu einer Masturbation auf der Krankenhaus-Toilette hinreißen lässt), fährt Jennifer zu Anne und Kadir an den Tegernsee. In einem euphorischen Moment wirft sie ihr Mobiltelefon aus dem Fenster des Autos. Da ist es wieder, dieses Gefühl von Freiheit. Sie lernt Kadirs Bruder Nermin und seine Frau Sabine kennen. Nermin, der Oberregierungsrat, hat soeben seine anderthalb Jahre Elternzeit für den dreijährigen Friedrich beendet. Ohne Geld, wie Sabine, die Chirurgin, klagend feststellt; Geld, dass sie vermisst. Die Schuld trägt Friedrich. Der muss es nun ausbaden, wird ständig beschimpft. Kadir scheint der einzig halbwegs Vernünftige zu sein, er geißelt den deutschen Selbsthass und die allgegenwärtige »leere Moral«, nimmt seinen Bruder zur Seite, weil ihm Sabines Verhalten dem Kind gegenüber missfällt. Als sich Sabine über die »Müllfee« Peter amüsiert, der im Nobelviertel auch bei Regen und Schnee die Mülltonnen der Bewohner ausräumt und falsche Sortierungen rückgängig macht, platzt Kadir der Kragen: »Peter ist das soziale Gewissen. Er ist der letzte Anständige.« (Und ich frage mich, ob das nicht auch ein guter Titel gewesen wäre.)
Jan entlässt sich aus dem Krankenhaus, fährt auf eigene Verantwortung zur 96jährigen, bettlägerigen, lebensmüden Großmutter. Man kommt sich näher, er muss sich überwinden, sie auszuziehen und zu duschen. Er fragt sie, was sie hätte werden wollen. Und sie versteht nicht einmal die Frage. Als ob es eine Wahl gegeben hätte. Menschen seien nicht »entweder oder« sagt sie zu Jan, der immer wieder die Nazi-Zeit ins Spiel bringt. Während Jan in der Krefelder Innenstadt einige Delikatessen für ein Silvester-Menü einkauft und dabei zusammengeschlagen wird, machen Jennifer, Anna und Kadir einen Ausflug zur Zugspitze. Nermins Familie fehlt überraschend. Spätestens hier fragt man sich, wie der Autor aus diesem Plot herauskommt, ohne in Kitsch oder Klischees zu verfallen. Und ist dann überrascht. Er schafft es. Wie, das wird nicht verraten.
Und ja, dieser Jan ist mit seinem moralinsauren Impetus ein bisschen überzeichnet und Jennifers Hedonismus wirkt bisweilen trotzig-aufgesetzt. Dennoch ist Gute Menschen ein gelungener Gegenroman zu all jenen Pop-Romanen, deren Protagonisten sich eine Atmosphäre aus aufgesetzter Coolness und romantizistisch parfümiertem Eskapismus zusammengebastelt haben, um am Ende entweder in Dauerschwermut oder wohlfeilem Zynismus auf die Welt zu blicken.
Der Roman verspottet den vom Shitbürgertum forcierten Mainstream der formvollendeten Banalisierung, etwa jene »Podcasts« genannten »Bordell[e] dieser neuen Gegenwart« und ihre Protagonisten wie (exemplarisch) Joko Winterscheidt, Sophie Passmann, Oliver Pocher, Tommi Schmitt, Montana Black, Klaas-Heufer Umlauf oder einfach nur Radiomoderatoren, die sich über das Kacken und Missoirs auslassen. Jan und Jennifer sind zwar Antipoden, haben aber eine Gemeinsamkeit: Sie suchen auf ihre unterschiedliche Weise Distanz vor der allumfassenden Verblödung, der man sich auch noch mehr oder weniger freiwillig aussetzt und deren Folgen man am Personal in Politik, Medien und Wirtschaft erkennen kann. Es ist kein dezidierter Roman über die Generation Y, eher ein Sittenbild einer Zeit, in der Gewissheiten erodieren und Verluste sichtbar werden. Das alles wird ohne Zeigefinger, ohne Appell, ohne Verklärung der Vergangenheit, ohne Deklaration, was richtig oder falsch ist erzählt. Schwilden erhebt sich nicht über seine Protagonisten; sie sind und bleiben völlig unironisch »gute Menschen« (keine »Gutmenschen«). Das Weitere ist Schicksal. Man wird dieses Buch vermutlich immer wieder, im Abstand von zwei, drei Jahren, zur Hand nehmen. Nicht auszuschließen, dass man dann in Nostalgie verfällt.
