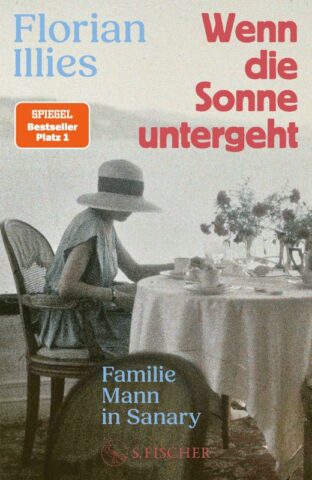
Er ist wie immer: Künstler- und vor allem Schriftstellerjubiläen verdrängen fast immer die primäre Beschäftigung mit dem zu würdigenden Werk zu Gunsten meist launig, eher selten erhellender Tertiärlektüre. Wer die Bestsellerlisten 2025 zur Kenntnis nimmt, findet dort eine Menge Bücher über Thomas Mann, aber keines von ihm.
Woran liegt es? Zum einen locken hemdsärmelig vorgebrachte Interpretationshilfen mit denen man sich vielleicht die Lektüre der inzwischen eher sperrig empfundenen Werke ersparen könnte. Und zum anderen wird der Dichter – zeitgemäß halt – mal mehr, mal weniger sanft vom Thron gestoßen. Dabei schreckt man, wie unlängst geschehen, auch nicht vor der Ausbreitung intimster Details zurück. Das dient längst nicht mehr der Erschließung des Œuvres, sondern erinnert eher an irgendwelche bunten Blätter, die mit Pseudoskandalen an niedrige Instinkte appellieren.
Im letzten Jahr reüssierte Florian Illies, der Daniel Kehlmann des Feuilletons, mit einem Buch über Caspar David Friedrich, in dem er aus allen möglichen Quellen längst Überliefertes in schmissig-rührigen Prosakitsch überführte. Es war wohl unvermeidbar, dass sich Illies nun auch noch des Thomas-Mann-Jubiläums annimmt. Schließlich ist niemand mehr da, der sich wehren kann.
Illies untersucht in seinem neuesten Buch mit dem süßlichen Johannes-Mario-Simmel-Titel Wenn die Sonne untergeht die Irrungen und Wirrungen der Familie um Thomas Mann im Jahr 1933, dem Jahr, in dem Hitler Reichskanzler wurde. Schon in Uwe Wittstocks Februar 33 wurde auf beklemmende Weise deutlich, wie rasch das demokratische Gerüst der Weimarer Republik unter der aufbrausenden Nazi-Herrschaft zusammenbrach und welche gravierenden Veränderungen binnen kurzer Zeit eintraten. Illies beginnt am 11. Februar 1933, dem Tag, an dem Thomas Mann mit einer Frau Katia den Zug nach Amsterdam betritt. Es ist der Beginn einer Vortragsreise über Richard Wagner, der das Paar noch nach Brüssel und Paris führt, bevor es dann für drei Wochen nach Arosa in einen Winterurlaub gehen soll. Was die beiden nicht wissen können: Sie werden ihr Haus in der Poschingerstraße 1 in München, in dem sie mehr als 18 Jahre gelebt haben, nie mehr wiedersehen. Thomas und Katia ahnen die Entwicklungen der nächsten Wochen nicht annährend voraus und wiegen sich noch lange in trügerischer Sicherheit. Der Bruder Heinrich Mann hingegen ist hellsichtiger. Er wurde vom Vorsitz der »Sparte Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste« suspendiert und tritt wenige Tage später, am 21. Februar, den Zug in die Migration mit Ziel Frankreich an. Seine lebenslustige Freundin Nelly Kröger lässt er zurück. Es ist der gleiche Tag, an dem Klaus und Erika Mann, die ältesten Kinder von Thomas, ihren Pfeffermühle-Ball in der Poschingerstraße feiern.
Von nun an wird jede Nuance, jede Begegnung (oder Nicht-Begegnung), jede Befindlichkeit der Protagonisten rekonstruiert und gemeldet. Die Spielorte changieren zunächst zwischen Arosa, Paris, Berlin und München. Weniger mondän geht es in Göttingen zu, wo sich Golo Mann auf sein Staatsexamen fürs Lehramt vorbereitet (dazu wird es allerdings nicht kommen). Ausgiebig werden sowohl die (fast immer) homosexuellen Liebschaften von Klaus, Erika und Golo gespiegelt werden wie auch die Drogenkonsumationen der ältesten Kinder. Dann gibt es noch Thomas’ Verleger Gottlieb Bermann Fischer, der die Verhältnisse verharmlost und unbedingt den ersten Band der Joseph-Romanreihe in Nazi-Deutschland herausbringen will. Er wird am Ende des Sommers Thomas Mann in einen veritablen Gewissenskonflikt mit seinem Sohn Klaus stürzen. Bermann Fischer wird das »gewinnen« – Thomas Mann sagt sich als Mit-Autor der von Klaus editierten Zeitschrift Die Sammlung los, die mit einem polternden Aufsatz von Heinrich Mann den Zorn der Nazis auf sich gezogen hatte.
In den drei Wochen Arosa überschlagen sich die Ereignisse. Thomas Mann nimmt nachts Trost bei Schlafmitteln und Tolstoi. Zunächst zieht man noch die Möglichkeit der Rückkehr nach Deutschland in Betracht, aber schließlich gibt man den sorgenvollen Einwänden von Freunden nach. Während Heinrich in Nizza ankommt, reisen Thomas und Katia zunächst einmal quer durch die Schweiz. Erst Lenzerheide, dann bei Hermann Hesse in Montagnola ein paar entspannte Tage; schließlich Rorschach und Basel. Das Lieblingskind Elisabeth (»Medi«) geht noch einmal zurück zur Schule nach Deutschland, kehrt jedoch rasch wieder zurück. An normalem Unterricht ist nicht zu denken. Golo versucht, in München Geld abzuheben und außer Landes zu bringen. Schließlich packt er auch noch den Koffer mit den Tagebüchern von Thomas Mann; Diskretion des Sohnes Ehrensache. Nicht auszudenken, wenn die Nazis diese in die Hände bekämen. All die Geheimnisse des Dichters sind dort aufgeschrieben. Über vier Wochen wird der 38 kg schwere Koffer benötigen, bis er schließlich im französischen Exil ankommt. Später wird klar, dass man ihn tatsächlich geöffnet und die ebenfalls dort deponierten Honorarverträge von Thomas Mann ausgewertet hatte, um die Vermögensverhältnisse des Dichters festzustellen. Das erklärt, warum Golo wenige Tage später kein weiteres Geld mehr bekam; die Konten waren gesperrt. Es bleiben 60.000 Reichsmark in bar. Jedes Detail der Rückholung dieses Geldes (inklusive Umtausch) wird Illies schildern. Am Ende haben die Manns ein Bankvermögen von rund 200.000 Franken oder 1 Million Francs gerettet.
Der Untertitel des Buches – »Familie Mann in Sanary« – ist leicht missverständlich. Denn erst am 12. Juni zieht die Familie in die Villa »La Tranquille« (»Die Ruhige«) in Sanary-sur-mer, einem 3.000 Einwohner-Städtchen an der Côte d’Azur, in dem hauptsächlich Fischer und Bauern lebten. Zuvor war man in einem Hotel in Bandol untergekommen. Es sollte das Beste am Ort sein, war aber Quell zahlloser Meckereien von Thomas Mann. Ein geregelter Tagesablauf, wie er ihn braucht, um schöpferisch tätig werden zu können, war nahezu unmöglich. Klaus und Erika lebten zeitweise im Hotel La Tour in Sanary. Heinrich blieb in Bandol.
Der Vorteil Sanarys gegenüber den Küstenmetropolen lag nicht nur in den niedrigeren Mietpreisen, sondern auch in der Beschaulichkeit des Ortes. Der im Laufe des Sommers zu einer Art Vertrauter von Thomas Mann werdende Schriftsteller René Schickele knüpfte den Kontakt zu der zu Einheimischen gewordenen Sybille Gräfin Schoenebeck (spätere Sybille Bedford) und deren morphiumabhängige Mutter Lisa Marchesani. Beide lebten dort seit Mitte der 1920er Jahre. Im Nu waren Sommerhäuser gefunden. Illies spart nicht mit Idyllenbildern, die man aus den Filmen von Heinrich Breloer (Die Manns – Ein Jahrhundertroman) und Anatol Regnier (Jeder schreibt für sich allein) kennt. Der enorme logistische Aufwand der diversen Umzüge wird am Rande thematisiert; das war Sache des Personals, das zunächst aus Einheimischen bestand. Später werden immer mehr Hausgegenstände aus München in Sanary eintreffen, gegen Ende des Sommers gelingt es Erika in einem Coup noch einmal 40 Kisten Hausstand in die Schweiz zu bringen, bevor die Nazis endgültig das Gebäude besetzten.
In Sanary-sur-mer kommt Thomas Mann zur Ruhe; eine gewisse Ordnung kehrt zurück. Klaus versucht, aus den Niederlanden heraus seine Literaturzeitschrift herauszubringen. Er und Erika drängen den Vater zu einer dezidierten, öffentlichen Stellungnahme gegen die Nazis. Der zögert, war hin- und hergerissen zwischen den Mahnungen und Wünschen seiner ältesten Kinder und den Beschwichtigungen seines Verlegers, der sogar auf eine Rückkehr der Familie nach Deutschland drängte und sich als Statthalter der Leser seines Autors gerierte. Er wollte, dass Mann kooperiert, legte ihm nahe, dem »Reichsverband der deutschen Schriftsteller e.V.« beizutreten. Das tat Thomas Mann nicht. Ansonsten fügt er sich seinem Verleger – nicht zuletzt aus finanziellen Erwägungen.
Dabei war Mann längst einer offenen Verleumdungskampagne bezüglich seiner (absichtlich falsch verstandenen) Wagner-Rede ausgesetzt. Als im Herbst doch noch der erste Joseph-Roman in Deutschland erscheinen konnte, wurde dies von der jüdischen Gemeinde als Hoffnungszeichen gesehen. Bis zuletzt hegten Katias Eltern, die Pringsheims, die mit voller Wucht die Nazi-Entrechtungen mitbekamen, noch Hoffnung, glaubten an eine kurzfristige Episode des Regimes, trotz Reichstagsbrand, Bücherverbrennungen und Ausbürgerungen.
Der eigentliche Aufenthalt in Sanary dauerte nur etwas mehr als drei Monate. Im Sommer füllt es sich mit Migranten, die Illies als »Siedler von Sanary« bezeichnet, als handele es sich um ein Gesellschaftsspiel. Golo Mann nannte sie Jahrzehnte später treffender »gefallene Größen«. Neben den Schoenebecks und René Schickele fanden sich Lion und Marta Feuchtwanger und Arnold und Beatrice Zweig nebst je »befreundeten Sekretärinnen« ein. Es lebten dort Aldous und Maria Huxley und die Malerin Eva Herrmann, die, wie es einmal heißt, eine Art siebtes Kind der Manns wird. Der soignierte »Baron«, den die Frauen »Spatzi« nannten, war ein gewisser Hans Günther von Dincklage; vermutlich ein Agent der Deutschen, was freilich niemand ahnte. Heinrich Mann konnte in seinem Quartier in Bandol im Juni seine Nelly nach einer Odyssee quer durch Europa begrüßen. Golo kam ab August beim exzentrischen Anthropologen und Schriftsteller William Seabrook unter. Im Laufe des Sommers schauten auch Ludwig Marcuse und Bertold Brecht vorbei. Man unterhielt sich mit Hausmusik, Leseabenden und Gartenpartys. An den diversen intimen Spielereien zwischen den einzelnen Damen und Herren, im Buch mit Wonne ausbreitet, blieben die Manns unbeteiligt.
Illies zeichnet die Monate Februar bis September 1933 in allen Facetten. Als Quellen dienen Tagebücher (insbesondere jenes von Thomas Mann) plus »eine unübersehbare Menge an Literatur« sowohl »über die Manns« als auch über die anderen Protagonisten. Es sind wohl so viele Quellen, das er den Leser nicht mit deren Aufzählung langweilen möchte, sondern spröde einigen Personen dankt, mit denen er gesprochen hat. Detaillierte Nachweise, wie man sie zum Beispiel im gelungenen Buch von Martin Mittelmeier über das Exil der Manns in Pacific Palisades findet und die den interessierten Leser auf weitere Spuren bringen könnten, fehlen.
Das Fehlen dieser Nachweise erzeugt eine Aura der Allwissenheit. Da weiß jemand, wie Thomas Mann ein neues Tagebuch beginnt und dabei über die Seite wischt. Er weiß, wie dieser am 11. Februar 1933 »die Münchner Haustür mit lübeckischer Entschiedenheit« hinter sich zuschließt. Er extrapoliert eine Sentenz von Klaus Mann zum »Artikel 1 des Grundgesetzes der gesamten Familie Mann« und checkt Katias Bündnis als »Ehe mit Tempolimit«. Gönnerhaft dann: »Wir dürfen diese Beziehung zwischen Thomas und Katia Mann ruhig Liebe nennen.«
Mehrfach wird der (übergriffige) Autorenplural verwendet, etwa im Kommentar zu Monikas Telegramm, in dem sie den Eltern ihre Ankunft ankündigt, was »für uns so unerwartet wie für Katia und Thomas Mann« kam (man beachte die Reihenfolge). Überhaupt Monika – bei ihr zeigt Illies besonderes Einfühlungsvermögen. So weiß er, dass Monika schon »vor ihrer Geburt« gelernt habe, »die Kreise des Vaters nicht zu stören«, indem sie nicht am 6. Juni (dem Geburtstag des Vaters) zur Welt kam, sondern erst am 7. Einmal sitzen Katia und Monika am Küchentisch. »›Du bist mir ein Rätsel, Liebes‹«, sinniert die Mutter, woraus Illies Katias »Abneigung gegen die eigene Tochter« herausliest, die »immer noch mit Höflichkeit möbliert« gewesen sei. Und dann folgt ein hübsches Beispiel für Illies’ bisweilen ausufernden Hypothesenrausch: »Und Monika, die versonnen auf den angewelkten Blumenaufsatz in der Mitte des Tisches blickt, denkt bei sich vielleicht: ›Ja, ein Rätsel, das bin ich mir auch.‹« (Hervorhebungen von mir.) Als Monika im Herbst 1933 nicht mit der Familie nach Küsnacht geht, sondern sich im nachsommerlichen Toulon »mit einem Klavier« einmietet, wird daraus ein Kalauer mit Fremdscham-Potential: »Wenn es draußen schon so heiß ist, dann hilft vielleicht das wohltemperierte Klavier.«
Abneigungen entdeckt Illies auch bei Katias Verhältnis zu Michael, genannt Bibi. So soll sie einst ihrem Mann versprochen haben: »›Ich will dir noch ein feines Söhnlein schenken, weil ich doch mit dem Bibi deinen Geschmack so gar nicht getroffen habe‹.« Dazu kam es dann nicht mehr. Außer Elisabeth hatten alle Kinder ihre Probleme sowohl mit dem Übervater als auch mit der Mutter, die immerhin je nach Bedarf die Schecks ausstellte. Neu ist das alles wirklich nicht. Und freilich bleibt Illies abseits der Mutmaßungen nicht ohne Fehler und Widersprüche, etwa wenn es einmal 45 Unterschriften zum »Protest der Richard-Wagner-Stadt München« sind, ein andermal 43.
Thomas Manns Lebenserschütterung mit 57 Jahren, dieses trotzige Nicht-wahrnehmen-Wollen der sich abzeichnenden Katastrophe parfümiert Florian Illies mit einem anmaßenden, schwer erträglichen Gouvernantenton. In einem Gespräch mit Gero von Boehm sagte Golo Mann 1989, sein Vater hätte sich als der »letzte Deutsche« gesehen. Folgt man Illies Recherchen, sah Thomas Mann sich als »symbolische Existenz«. Später, bei der Ankunft 1938 in den USA kumulierte dies in dem Satz: »Wo ich bin, ist Deutschland.« Thomas Mann nahm diese Existenzform für sich an, als Bürde, als Verpflichtung. Deswegen wird er bisweilen halb anerkennend, halb spöttisch als »Praeceptor Germaniae«, also »Lehrmeister Deutschlands«, bezeichnet. Illies will die Ironie des Meisters nachahmen, sieht sich wohl als »Praeceptor Praeceptoris Germaniae«, ein Lehrmeister des Lehrmeisters. Das misslingt krachend. Schade um die Zeit; man hätte stattdessen besser zwei Novellen von Thomas Mann wiederlesen sollen.
