Porträt des musischen Informatikers Peter Reichl
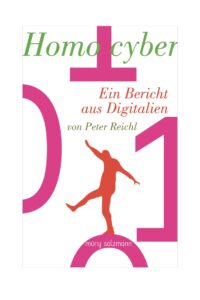
Homo cyber, der kybernetische Mensch. Nicht zu verwechseln mit dem Cyborg, der maschinelle Prothesen in seinen Körper integriert hat. Freilich tendiert auch der kybernetische Mensch dazu, sich digitale Geräte einzuverleiben. Beobachtet man Passagiere in der U‑Bahn, gewinnt man den Eindruck, dass sie ihr intelligentes »Telefon« gar nicht mehr loslassen, als könnten sie ohne es nicht existieren.
Homo viator, homo ludens… Es gab in der Vergangenheit noch andere feste Wortverbindungen mit »homo«. Homo faber – der Macher, Handwerker, Techniker – tritt im gleichnamigen Roman von Max Frisch als Inbegriff des Ingenieurs auf. Peter Reichl, der die neue Wortverbindung geprägt hat und als Buchtitel verwendet, kommt in den beiden bisher erschienen Bänden1 mehrfach auf Max Frisch und seinen Ingenieur zu sprechen. Anscheinend haben der Kybernetiker, der Informatiker, der Programmierer, aber auch der gemeine »User« von Personalcomputer und Smartphone, den Ingenieur als Leitfigur der Moderne abgelöst. Der Homo sapiens hat sich zum Homo cyber gewandelt.
In der biographischen Notiz am Ende von Reichls Buch erfahren wir zu unserer Überraschung, dass der Autor Informatikprofessor an der Universität Wien ist. Gut, der Mann hat vielerlei mitzuteilen, und manches davon geht nicht so leicht in einen mathematisch ungebildeten Kopf, obwohl da von sehr alten, verhältnismäßig einfachen Problemstellungen die Rede war. Gleichzeitig aber waren in dem Buch Haltungen ausgedrückt, Schlussfolgerungen formuliert und Vorschläge gemacht, zu denen ich selbst auf anderen Wegen gelangt war, etwa in dem Buch Parasiten des 21. Jahrhunderts. Als digitaler Skeptiker – wie der Informatikprofessor selbst? – beschloss ich, mehr darüber herauszufinden, wollte aber alles Googeln vermeiden.
Reichls Büro befindet sich in einem zweistöckigen containerartigen Annex der Wiener Fakultät für Informatik. Das Gebäude muss demnächst wieder abgerissen werden, an seiner Stelle wird dann, wer weiß für wie lange, wieder eine Baulücke sein. Was an Reichls körperlichen Erscheinung zunächst auffällt, ist der graue, fast weiße Rauschebart, dazu kleine, springlebendige Augen hinter der eckigen Brille. Eine gewisse Fülligkeit ist nicht zu verleugnen – man könnte den Mann mit der kräftigen Stimme für einen Opernsänger halten, und tatsächlich wäre er in jungen Jahren fast ein solcher geworden. Auf den Arbeitstischen stehen kleine, altertümliche Rechenmaschinen, wie ich sie von Ablichtungen in den beiden Büchern kenne. Reichl liebt es, auf die Frühgeschichte der Informatik hinzuweisen, deren Beginn man etwa 1623 ansetzen kann. In diesem Jahr erfand der deutsche Gelehrte Wilhelm Schickard eine Rechenmaschine, mit der man vielstellige Zahlen addieren, subtrahieren und multiplizieren konnte.
Die Kenntnis solcher frühen, noch tastenden Ansätze fördert das Verständnis für kybernetische Prozesse, die im 20. Jahrhundert einen hohen Komplexitätsgrad erreichten. Einer der beiden Tische weist eine unscheinbare Arbeitsfläche aus irgendeinem Kunststoff auf. Es ist der Schreibtisch, an dem Douglas Hofstadter arbeitete, als er 2017 ein halbjähriges Sabbatical in Wien verbrachte. Reichl hält mit seiner Hochschätzung für zahlreiche Kollegen nicht hinter dem Berg; mit einigen von ihnen verbinden ihn persönliche Beziehungen. An der Bürotür hängt außen immer noch ein Schild mit Hofstadters Namen und eine Ankündigung seines Vortrags über Analogy as the Core of Cognition. Ein verlockender Titel!
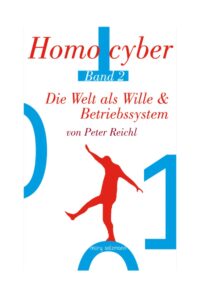
Hofstadter gelangte durch sein Buch Gödel, Escher, Bach – ein Endloses Geflochtenes Band zu allgemeiner Berühmtheit. Der Geist eines anderen bedeutenden Mannes strahlt von der Wand neben dem Schreibtisch. Dort befindet sich hinter Glas ein handgeschriebener Brief von Günther Anders an seinen Philosophenkollegen Jean-Paul Sartre. »Ich liebe ihn heiß«, sagt Reichl, der seine Überlegungen zur Digitalisierung der Welt und ihren Gefahren mit den Warnungen Anders‘ vor der Selbstauslöschung der Menschheit durch Atomwaffen parallel setzt. Das ist eine der für mich ungelösten Fragen nach der Lektüre von Homo cyber I und II: Wie dramatisch, gar apokalyptisch sind die vorgängigen technologischen Änderungen wirklich? Was ist ihr anthropologischer Stellenwert? Wie tief der Einschnitt?
Konrad Paul Liessmann, Reichls Kollege an der Universität Wien, hatte Ende des vorigen Jahrhunderts wesentlich zur Wiederentdeckung von Günther Anders und seiner Nachkriegsphilosophie beigetragen. Auch zu Liessmanns eigenen Arbeiten, etwa zur Theorie der Unbildung, weist Homo cyber Verbindungen auf, denn Reichl geht es nicht nur um die Grundlagen der Informatik, sondern viel mehr noch darum, kulturelle Kontexte und Auswirkungen auf das menschliche Zusammenleben zu benennen. Bildung spielt dabei eine, wenn nicht die wesentliche Rolle, er selbst sieht seine Aufgabe vor allem darin, das Bewusstsein vor allem junger Menschen wecken und schärfen zu helfen, was Informatik, Digitalisierung und tägliche mediale Praxis mit uns machen und wie wir uns dazu verhalten können/sollen.
In einer Ecke von Reichls Arbeitszimmer versteckt sich eine Druckgraphik von Picasso, Don Quijote und Sancho Pansa darstellend: Windmühlenkämpfer und Stichwortgeber. Seine Vorlesungen hält Reichl im Auer von Welsbach-Hörsaal drüben in der Fakultät für Chemie, wo einst auch Albert Einstein saß. Solche Verbindungen, zuweilen heterogener Natur, sind ihm wichtig, er reflektiert sie nicht nur, sondern genießt sie sichtlich, und so ist er auch zum Sammler geworden, vor allem während der Corona-Lockdowns, zum Beispiel erwirbt er gern Briefe der oder an die italienischen Operndiva Giuditta Pasta (1797–1865). In seiner Freizeit hat er zusammen mit seiner Frau Marena Balinova, einer ausgebildeten Sängerin, ein Programm mit Beispielen ihrer Rollen zusammengestellt, das die beiden unter dem Titel »Pasta Diva – The Glory of Belcanto« präsentieren.
Reichl begleitet aber nicht nur am Klavier, er spielt auch Geige und singt gelegentlich eine Canzone oder eine Arie, etwa bei Festveranstaltungen der Universität Wien. Bei unserem Gespräch erzählt er von den Gesangsstunden, die er als junger Mann in Mailand nahm, während er an der ETH Zürich studierte. Im Teatro Puccini in Meran hatte er sein erstes Engagement, er sollte dort den Grafen Almaviva im Barbier von Sevilla geben, doch daraus wurde nichts, nachdem die Kostümgarderobe abgebrannt war. Ein Wink des Schicksals, Reichl sollte den Weg des Wissenschaftlers einschlagen, ohne freilich je auf die »Ergänzung«, wie er es nennt, durch die schönen Künste und deren Fokussierung auf menschliche Gefühle zu verzichten.
Diese Zweigleisigkeit war schon in München gegeben, wo er Mathematik und Physik studierte. Damals ging er an zirka 150 Tagen des Jahres in die Oper; er hat, ganz Sammler, sämtliche Eintrittskarten aufbewahrt. Einerseits sieht Reichl auch in Theoriegebäuden und technischen Konstrukten Schönheit am Werk; andererseits versucht er in seinem »Bericht aus Digitalien« Möglichkeiten der Ästhetik aufzuspüren. Mit Bezug auf den Philosophen Byung-Chul Han diskutiert er die »Glätte« digitaler Apparaturen und Kommunikationsformen. Meinen Einwand, daß es im Internet oft ziemlich rau zugehe, hat er bereits in Homo cyber berücksichtigt und besprochen. Und auch Han ist ja mit dieser Glätte unzufrieden, sie führe eher zu einer Anästhetik, die den Bereich der zwanghaften »Likes« charakterisiere, statt zu neuer Schönheit. Letztlich entsteht dann doch der Eindruck, daß Ästhetik auf die sogenannte analoge Welt angewiesen bleibt.
Wahrhaft ästhetisch ist und bleibt die reale Welt, in der wir uns leibhaftig bewegen. Reichl gehört zu denen, die nicht auf eine reale Existenz verzichten möchten, auch wenn die virtuelle Welt ungeheure Möglichkeiten vorgaukelt. In seiner Einführungsvorlesung über die Grundlagen der Informatik wird er immer wieder mal gefragt, ob denn die Vorlesung nicht »gestreamt« werde. Nein, ist seine Antwort, und er weist die Studenten darauf hin, daß gerade die Augenblickshaftigkeit mit der Realpräsenz des Professors die Chance sinnlicher Wahrnehmung und der entsprechenden Eindringlichkeit wie auch Konzentration biete, während dies beim, sei es auch wiederholten, Nachhören und Nachsehen in der trügerischen Ewigkeit des Internets nicht der Fall sei. Am wohlsten fühlt sich Reichl beim Gespräch, in der nicht virtuellen, sondern aktuellen Kommunikation. Und wenn es sich um eine Vorlesung vor zahlreichem Publikum handelt, dann ist er immer auch Darsteller auf einer Bühne, der seine Rolle spielt, wie es der Schauspieler und der Opernsänger in ihrem Kontext tun.
Etwas von dieser Theatralik spüre ich in seinem Büro, unter vier Augen, als er vom runden Tisch aufsteht und zur Tafel geht, um eine Zahlenreihe aufzuschreiben und mir zu demonstrieren, daß es verschiedene Methoden des Wurzelziehens gibt und sich diese hier gut eignet, um den Vorgang maschinell erledigen zu lassen. So einfache Beispiele hat er sicher schon tausendmal vorgeführt, und dennoch verraten seine Stimme und sein Körper eine Begeisterung, die unfehlbar auf den Schüler übergeht. Seine Homo-cyber-Bücher hat Reichl mit derselben pädagogischen Verve geschrieben und mit Schichten und Spitzen versehen, die abstrakte Diskurse anschaulich machen, Unterhaltung als Surplus zur Erkenntnis bieten und Aha-Erlebnisse liefern. Aut prodesse volunt aut delectare poetae, zitiert Reichl das alte Diktum des Horaz, das uns beiden als ehemaligen Schülern humanistischer Bildungsanstalten geläufig ist und das auch sein engerer Landsmann Bertolt Brecht gern zitierte. Nur daß die Dichter, neugierig auf die Fortschritte der Wissenschaft, von der Seite ergötzlicher Ästhetik kommen, die Wissenschaftler hingegen von der des nützlichen Studiums.
Den Unterhaltungswert in den schriftlichen wie auch mündlichen Darbietungen Reichls empfinde ich oft als Humor. Die Person selbst, erkenntlich an ihrem Stil, hat etwas Heiteres. Heiter nicht im Sinn von Spassmacherei, sondern der Gelassenheit der alten Stoiker, die zuweilen von serenitas. Reichl gebraucht im Gespräch einmal das Wort »Kulturpessimismus«. Liest man seine Ausführungen ohne Rücksicht auf die Heiterkeit ihres Stils, so könnte man wirklich zum Schluß kommen, unsere menschheitlichen Aussichten seien niederschmetternd trüb. Zu allem Überdruss trägt die Informatik, also Reichls Fach, einen Gutteil der Schuld daran. Deprimierend! Aber depressiv macht einen der Umgang mit diesem Mann, dem im hochdifferenzierten 21. Jahrhundert etwas vom Universalgelehrten anhaftet, eben nicht, im Gegenteil. Man kann es auch physikalisch sehen: Pädagogik ist, genauso wie die Vermittlungsarbeit der Kunst, eine Frage der Energie. Jemand, der viel Energie hat, möchte und muß sie versprühen, aber nicht sinnlos, das heißt: Er möchte sie übertragen. Und genau das geschieht bei der Lektüre der Bücher ebenso wie im Gespräch.
Der Kulturpessimismus hat eine altehrwürdige Tradition, doch zum Glück sind die Ahnungen, ist das Unbehagen der älteren Weisen nicht durchwegs Wirklichkeit geworden. Auf das Phänomen der Verrohung der Kommunikation und der systematischen Reizüberflutung in den Sozialen Medien geht Reichl mündlich noch einmal ein. Man kann dieses Phänomen nämlich durch eine Analogie zu einem technisch-ökonomischen Phänomen erhellen, mit dem er sich beschäftigte, als er vor dem Beginn seiner akademischen Karriere bei einem Forschungsinstitut verschiedener Telekommunikationsanbieter tätig war.
»Hohe Nachfrage«, schreibt er im Buch, »führt aufgrund der beschränkten Bandbreite zu schlechterer Qualität, diese läßt sich nur billig verkaufen, was wiederum die Nachfrage weiter erhöht, die Qualität weiter nach unten treibt – ein typisches race to the bottom also. Als Ergebnis landet man letztlich an einem Gleichgewichtspunkt, in dem dies schlechte Qualität für alle umsonst haben.« Genau, im Internet wollen wir alles gratis haben, niemand ist bereit, für Qualität zu zahlen, die Einnahmen der Tech-Firmen geschehen hinter unserem Rücken, durch Werbung und Datenverkauf. Wenn nun aber die hier skizzierte Dynamik unaufhaltbar ist, ergibt sich zwangsläufig eine »Stabilität der Hässlichkeit«, was wiederum bedeuten würde, »daß ein ›schöner‹, also politisch konstruktiver Diskurs im Netz prinzipiell unmöglich wäre. Trübe Aussichten also.«
Aussichten eines Kulturpessimisten. Der sich, weil er gar nicht anders kann, stoischer Heiterkeit verschrieben hat. Die Erfolge der Rechtspopulisten wären, sofern Reichls Räsonnement zutrifft, unvermeidlich, weil durch eine weltbeherrschende, sich selbstläufig immer weiter entfaltende Technologie bedingt, die von ihren politischen Nutznießern aus Gründen der Isomorphie am geschicktesten bedient werden und die früher oder später von deren politischen Mitbewerbern nachgeahmt werden. Es gibt kein Entrinnen, wir leben bereits in einer Techno-Diktatur, wie sie einst Günther Anders aufgrund damaliger gesellschaftlicher Erfahrungen – die Atombombe, ebenfalls ein indirektes Resultat mathematisch-physikalischer Forschungen – an die Wand malte.
Reichl warnt, doch mit seinem schönen Tenor klingt er nicht wie eine Kassandra, eher wie ein glücklicher Sisyphos (im Sinne von Albert Camus). Unter diesem Stern bewegt sich Peter Reichl. Ich bin davon abgekommen, ihn zu fragen, ob er tatsächlich meine, daß wir uns Zuständen wie damals nähern. Letztlich muß jeder die Antwort selbst geben, und niemand kann sie derzeit definitiv geben. Reichl erzählt, wie er als Schüler zu wählen hatte zwischen Altgriechisch und Französisch als dritter Fremdsprache. Er entschied sich für Griechisch, weil er sich sagte, dies sei die einzige Chance in seinem Leben, diese Sprache zu lernen, später würde sie nicht wiederkehren. Wofür er plädiert, ist letztlich die Bewahrung überlieferter, aus der griechischen Antike stammender humanistischer Standards, das heißt vor allem: menschlicher Fähigkeiten, die wir trotz der höheren Perfektion und Geschwindigkeit der intelligenten Maschinen weiterhin pflegen sollten, sowie anderer, die von Maschinen, die kein eigenes Bewusstsein haben, auf absehbare Zeit keinesfalls erworben werden können. Diese begleitende Skepsis führt zu einer immer auch konservativen Haltung, die in seinem Fall mit einer intensiven Neugier für technische Erfindungen und Problemlösungen einhergeht. Der Humanist in ihm und, so steht zu hoffen, in uns allen, fügt solcher Neugier skeptische Fragen hinzu, ob wir das, was technisch machbar wird, überhaupt brauchen, ob es wünschenswert ist, welche unerwünschten Nebenwirkungen und Spätfolgen auf Menschen und Umwelt es haben kann. Wie wir mittlerweile aus Erfahrung wissen, sind diese massiv.

Homo cyber, bisher 2 Bände, erschienen im Salzburger Verlag Müry Salzmann 2023 bzw. 2024.
© Text: Leopold Federmair
© Foto Peter Reichl: Markus Kupferblum
