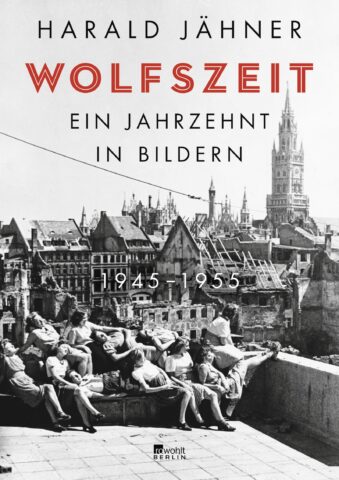
Nachdem er mit Höhenrausch die kurze Zeit im Deutschen Reich zwischen den Kriegen skizziert hatte, legte Harald Jähner 2019 Wolfszeit vor, ein, wie es im Untertitel heißt, »Jahrzehnt in Bildern»1. Gemeint sind die Jahre im Nachkriegsdeutschland von 1945 bis 1955. Es geht um Flucht, Vertreibung, Heimatlosigkeit, »Stunde Null«, Trümmer, Schwarzmarkt und Wirtschaftswunder aber auch um Schuld und Verdrängung. Jähner liefert sowohl Fakten und Zahlen, die das Ausmaß der von Deutschland und den Nazis verursachten Katastrophen und Verbrechen deutlich machen, streut jedoch immer wieder Erzählendes ein, indem er spotweise Schicksale und Ereignisse personalisiert und aus Tagebüchern und einstigen Zeitungsartikeln zitiert. Die bekannten Mythen werden nicht zwingend zerstört, aber mit der zeithistorischen Realität konfrontiert und geerdet.
So wird zum Beispiel deutlich, warum die Läden nach der Währungsreform 1948 plötzlich wieder voller Lebensmittel waren, nachdem zuvor Mangelwirtschaft den Ton angab. Es war halt kein »Wunder«. Auch was den Marshallplan angeht, rückt Jähner einiges zurecht, denn Deutschland erhielt nur einen Teil der Wiederaufbaugelder aus den USA. Großartig das Kapitel über die sich ausbreitende Trümmerikonografie, die bisweilen seltsame Blüten trieb, etwa in der Selbst- oder Fremdinszenierung inmitten von Ruinen. Auch die Ausführungen über den Segen des »Lastenausgleichsgesetzes« sind einerseits überzeugend, andererseits nicht jedem bekannt.
Jähner beschreibt eindringlich die »Wolfszeit«, jener von gegenseitiger Skepsis und Rücksichtslosigkeit geprägten Epoche des Handels auf den sogenannten Schwarzmärkten und erklärt, warum die Zigarette zur wahren Währung bis 1948 wurde. Er fragt, warum die Deutschen Skrupel beim Kohlenklauen oder Schwarzmarkthandel hatten, aber keinen Gedanken daran verschwendeten, als fünf Jahre zuvor ein Nachbar von der Gestapo abgeholt wurde. Natürlich geht Jähner auch auf die »Trümmerfrauen« ein, jene mystischen Eimerkettenbilder, die zeigten, wie Frauen den Schutt wegräumten (500 Millionen Tonnen sollen gewesen sein). Er zeichnet das Schicksal der »Displaced Persons« nach, jenen Menschen, die von den Nazis als Zwangsarbeiter missbraucht wurden und nun zurückführt, »repatriiert« werden sollten, berichtet von der logistischen wie institutionellen Überforderung der Alliierten zu Beginn, vom Fraternisierungsverbot der Amerikaner (die sich häufig nicht daran hielten) und den Vergewaltigungen der Roten Armee in den eingenommenen Gebieten. Letzteres wird versucht, zu erklären, ohne es zu rechtfertigen.
Nach der Lektüre von Wolfszeit wird man auch heute Wolfsburg nicht freiwillig betreten wollen, aber womöglich auf dem Dachboden einen Nierentisch suchen, denn der wird von Jähner zum Symbol für »entnazifiziertes Wohnen« deklariert. Da gehen dem Autor ein wenig die Pferde durch, was auch für die Formulierung von der »Entnazifizierung der Phantasie« durch die amerikanischen Künstler Rothko, Pollock und Motherwell gilt. Interessant immerhin, dass diese im Land selber höchst umstrittenen und eher angefeindeten Künstler von den Amerikanern als »Exportgut« eingesetzt wurden. Ich persönlich kenne allerdings niemanden, der diese Zeit bewusst erlebt hat, der von diesen Malern jemals etwas gehört hatte.
Man erfährt wie die sowjetische Propaganda rasch das Wort »Frieden« für sich besetzte, während die Bundesrepublik nach dem Gemeinsinn jenseits des Konsumismus suchte. Jähner beschäftigt sich mit dem Frauenüberschuss und den Problemen mit den Kriegsheimkehrern, die wieder Familienoberhaupt sein wollten, nachdem in deren Abwesenheit die Frauen ihr Leben ganz gut selbst organisiert hatten. Etwas lustlos wird Beate Uhse portraitiert. Griffiger sind die Ausführungen über Alfred Döblin und Hans Habe. Der »Kulturhunger« der Nachkriegsdeutschen ebbte nach der Währungsreform wieder ab; es ging ans Geldverdienen.
Immer wieder kommt Jähner auf die Verdrängungsleistung der Deutschen zu sprechen. Er konstatiert, es sei keine Verdrängung im »tiefenpsychologischen Sinn« gewesen. »Man verzieh sich die Naziverbrechen«, heißt es einmal. Jähner spricht von Scham, die eine der Ursachen für das »kommunikative Beschweigen« (Hermann Lübbe) sein könnte. Und er vergisst nicht zu erwähnen, dass die Mehrheit mindestens loyal zu Hitlers Regime gestanden habe. Man möchte ergänzen: Die Opfer, die hätten widersprechen und aufrütteln können, lebten nicht mehr. Dennoch verurteilt Jähner die politische(n) Amnestierung(en) der »Mitläufer« (oder mehr?), die sich besonders öffentlichkeitswirksam in der Berufung Globkes als Chef des Bundeskanzleramtes zeigte, nicht und zitiert den Alten: »Man schüttet kein schmutziges Wasser weg, solange man kein sauberes hat.«
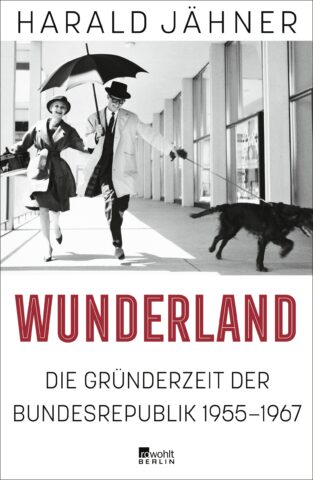
Es lag nahe, dass der große auch ökonomische Erfolg von Wolfszeit seine Fortsetzung findet. Mit Wunderland liegt nun die Besprechung der Jahre 1955 bis 1967 vor, die als »Gründerzeit« beschrieben wird und Harald Jähner endgültig zum Biograph der Bundesrepublik Deutschland macht. Duktus und Methodik sind ähnlich; es wird ein detailreiches Wimmelbild der Epoche gezeigt. Neben den gängigen Schlagworten geht es weiterhin um die »Verstehensgeschichte eines fatalen Achselzuckens«. Das Beschweigen des Holocaust und der Wehrmacht-Verbrechen setzte sich fort. Inmitten der ökonomischen Prosperität schien es schlicht keine Zeit dafür zu geben und man glaubte wohl, mit den Nürnberger Prozessen sei alles erledigt. Das auch die Intellektuellen schwiegen, stimmt dabei nur zum Teil. Ein Beispiel, das auch erwähnt wird, ist die nach dem Roman von Hans Scholz entstandene fünfteile Fernsehserie Am grünen Strand der Spree, die 1960 gezeigt wurde und ein großer Publikumserfolg war. In Das Tagebuch des Jürgen Wilms, der ersten Episode, gibt es eine Szene, in der in zweiundzwanzig Minuten eine Massenerschiessung an der jüdischen Zivilbevölkerung gezeigt wurde. Dennoch begannen sich viele sogar als »Opfer« zu fühlen, die »missbraucht« worden waren.
Jähner zeigt, warum es nicht spießig war, Ende der 1950er Jahre als Mann Anzug und Krawatte zu tragen, er analysiert Schelskys Diagnose von der »nivellierten Mittelstandgesellschaft« und stellt sie Dahrendorfs Analysen gegenüber. Immer noch zeigte sich ein Standesdünkel der ehemaligen Elite, die unerwünschte »egalitäre Effekte« befürchtete. Interessant, wie Jähner an der Kritik der sich annähernden Gesellschaftsschichten Parallelen zu den aktuellen Kritikern der Digitalisierung entdeckt – damals wie heute empfand man die »Symptome des sozialen Wandels« als Bedrohung.
Gelobt wird Theodor Heuß’ »bürgerliche Zivilität«, Entrüstung zeigt sich über das »pathologische Arbeitsethos« und Bewunderung für die unerschütterliche Zuversicht der Deutschen und dies nur wenige Jahre nach der Katastrophe. Natürlich fällt auch der Blick auf die Versäumnisse der Zeit, besonders die gedankenlose Verschmutzungen der Umwelt, nicht nur im Ruhrgebiet. Er schildert die eher bescheidene Behandlung der ersten »Gastarbeiter« (die anfängliche Verbringung in Lagern mit der NS-Zeit zu vergleichen, scheint allerdings übertrieben), klärt darüber auf, wie der Korea-Krieg den Aufschwung in Deutschland unterstützte, gibt eine kleine Kohlekunde, erhebt den Tankwart zum »Trivialheiligen der Mobilität«, skizziert das langsame, aber stetige Sterben des Lebensmitteleinzelhandels zu Gunsten anonymisierter Supermärkte (was eben auch mit einer Zunahme des Verpackungsmülls einher ging) und klärt auf, wie Neckermann und Horten ihre Versandimperien auf Nazi-Unrecht aufbauten und unangefochten in die neue Bundesrepublik überführen konnten.
Die Deutschen im Westen konsolidierten sich, erste Zechenstreben konnten mit anderen Arbeitsplätzen kompensiert werden; das Reden vom »Wunder« ging weiter um. Der aufkommende Wohlstand und das Streben danach fand Kritik bei links wie rechts, bei Gerd Gaiser (Schlußball) wie bei Hans Magnus Enzensberger. Letzterer »rezensierte« 1960 den Neckermann-Katalog in überheblichem Ton. Selbst dem »Vater« des sogenannten Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, wurde es unheimlich. Er riet zur Mäßigung.
Der Erzählung, erst die Achtundsechziger hätten ihre Eltern und Großeltern hinsichtlich ihrer Schuld gestellt, widerspricht Jähner. Es begann früher. Da war der Eichmann-Prozess 1961, die Auschwitz-Prozesse 1963 – beide fanden große mediale Aufmerksamkeit. Bis zur Ermordung Ohnesorgs 1967 war die APO dezidiert unpolitisch. Erst nach dem Attentat auf Rudi Dutschke begann die Politisierung nebst rascher Radikalisierung. Jähner zeigt hierfür in Grenzen Verständnis, spricht aber insgesamt diesem Handeln wenig Wirkung zu. Hier zeigt sich die Schwäche solcher Epochenzusammenstellungen: Die Folgen dieser APO, die Institutionalisierung durch die sozial-liberale Koalition und deren Versprechen eines Neubeginns von Demokratie, kann nur im Nachwort gestreift werden, denn das passierte erst in den 1970ern.
Jähner ist vor allem dann interessant, wenn er kurioses entwickelt, wie etwa die Deutung des Erfolgs von Konsaliks Der Arzt von Stalingrad, in dem die feindlichen Landser aus Russland und Deutschland plötzlich eine Art Schicksalsgemeinschaft bilden. Jähner sieht hier jenseits des Kitsches tatsächlich so etwas wie einen Russland-Mythos am Werk, der zum Erfolg der Bücher Konsaliks beigetragen hat und womöglich sogar heute noch wirkmächtig ist. Auch die Verortung der sich Mitte der 1960er Jahre immer mehr im Stadtbild zeigenden sogenannten »Gammler« als Pioniere dessen, was heute »Work-Life-Balance« heißt, ist mindestens originell. Verblüffend, wenn als Gemeinsamkeit zwischen Gammler und dem »Playboy« die Verweigerung der Arbeitsökonomie herausgearbeitet wird. Zwischendurch erhält man noch einen Crashkurs über Gerhard Richter, lernt etliches über (schwierigen) Anfänge der Beatles in Deutschland, diesen »Jungs, die in sich ruhten«, schließlich Furcht vor ihrem eigenen Erfolg bekamen und sich schnell trennten. Dass sich im deutsch-amerikanischen Verhältnis nicht viel geändert hat, sieht man daran, wie Kennedy gegenüber Adenauer feststellte, dass Deutschland nicht genügend für seine Sicherheit bezahle.
Immer wenn es eine dominante Interpretation aufgrund der Quellen zu geben scheint, setzt Jähner einen Kontrapunkt, der einem zurückholt und zugleich den Blick weitet. Er war so, wie man immer dachte und zugleich ganz anders. Etwas, was man früher Dialektik nannte. Sicher, es ist heute im Abstand von 60 Jahren leicht, Urteile über Fehler und Auslassungen abzugeben, aber darum geht es nicht. Er will nicht anklagen oder Recht behalten. Mich hat das an den »Schulfunk« erinnert, den ich in den 1970er Jahren sehr gerne hörte: Nachmittägliche Sendungen im Radio, Hörspielen gleich, in denen Sachverhalte, die im Politik- oder Geschichtsunterricht zu kurz kamen, ausgebreitet, von mehreren Seiten beleuchtet wurden und sich plötzlich neue Zusammenhänge zeigten.
Manchmal beißt sich Jähner an einem (scheinbar) abseitigen Thema fest und wird dann zeitweise zum Feuilletonisten. Auch wird einiges nicht oder nur oberflächlich erwähnt. So spielt beispielsweise in beiden Büchern die europäische Einigung eine eher untergeordnete Rolle. Adenauers Politik der Westbindung wird mit Wiederbewaffnung und der Mitgliedschaft in der NATO beschrieben, seine Aussöhnungen mit Frankreich und Israel bleiben unerwähnt. Auch die Wendungen in den Programmatiken der Nachkriegsparteien, innbesondere der CDU, kommen zu kurz. Immerhin bietet Jähner zu weitergehenden Studien eine umfangreiche Literaturliste an.
Man ist jetzt schon gespannt auf den Nachfolgeband ab 1968. Mit welchem Jahr wird er enden? Sind es vielleicht lange 1970er Jahre bis 1982? Und es gibt eine andere Frage: Ist der 1953 geborenen Jähner beim Wimmelbild der 1970er Jahre nicht durch die persönlichen Erlebnisse in der ein oder anderen Art befangen? Wir werden es lesen.
Ein aufmerksamer Leser korrigierte mich. Tatsächlich wurde Höhenrausch NACH Wolfszeit herausgebracht, nämlich 2022. ↩

Kleine Korrektur zum ersten Satz: „Höhenrausch“, Jähners Buch zur Weimarer Republik, erschien erst 2022, also nach „Wolfszeit“ (2019). Jähner hat sich in seiner Nachkriegs-Chronik eine Auszeit gegönnt bzw. einen (gelungenen!) Ausflug in die allerorten angesagte „Babylon Berlin“-Konjunktur. Ansonsten teile ich den Tenor dieser Rezension, dass die Wimmelbild-Methode dieses Sachbuchautors in ihrer Anschaulichkeit, bisweilen sogar in ihren Eigenwilligkeiten, sehr anregend ist.
Danke für die Richtigstellung. Werde es in einer Fußnote korrigieren.