Kamel Daouds preisgekrönter und umstrittener Roman Huris
Die Hauptfigur dieses Romans ist weiblich, 26 Jahre alt, sie lebt in Oran (Algerien) und trägt ein ewiges »Lächeln« unter dem Kinn. Lächeln zwischen Anführungsstrichen. Die deutschen Übersetzer Holger Fock und Sabine Müller haben es vorgezogen, die Anführungszeichen wegzulassen und durchgehend »Grinsen« zu schreiben. Durchgehend, insofern dieses Schlüsselwort vom Anfang bis zum Schluss sehr oft vorkommt. Es handelt sich um eine Narbe, die der jungen Frau nach einem Mordanschlag auf ihre Familie und ihr ganzes Dorf geblieben ist. Sie war damals fünf Jahre alt.
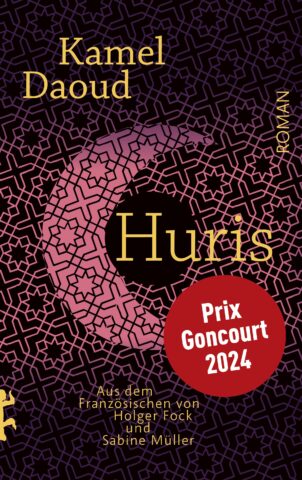
Im Algerien der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts kam es häufig zu solchen Grausamkeiten, das Durchschneiden von menschlichen Kehlen war bei den selbsternannten islamistischen Gotteskriegern besonders beliebt. Deren politische Partei hatte Anfang 1992 die Parlamentswahlen gewonnen, diese wurden unverzüglich – unter dem Beifall der europäischen Öffentlichkeit – annulliert. Die Herrschaft der FLN, die drei Jahrzehnte zuvor die Unabhängigkeit von Frankreich erkämpft hatte, wurde durch den islamistischen Terror (200.000 Todesopfer) nicht gebrochen, sie dauert bis heute an. 2019 entstand in Algerien eine junge, massenhafte, nicht religiös ausgerichtete Protestbewegung (»Hirak«), die letztlich der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Kamel Daoud, der Verfasser von Huris, sympathisierte anfangs mit dem Hirak, distanzierte sich jedoch bald davon.
Daoud sieht die wesentliche Aufgabe seines Romans darin, das Erinnern an die schwarze Dekade zu sichern. Im Vorspann zitiert er eine Passage aus der »Charta zur nationalen Versöhnung«, deren Bestimmungen Gesetzeskraft haben und 2005 in Kraft getreten sind. Die beiden Hauptfiguren, hinter denen ganz offensichtlich der Autor steht, sprechen bzw. schreiben ein ums andere Mal gegen die Vorschrift des Vergessens an. Nimmt man als Leser die Atmosphäre auf, die Daoud im Roman inszeniert, so kommt man zum Schluss, dass im gegenwärtigen Algerien ein stilles Einverständnis zwischen Islamisten, islamischem Mainstream und dem Militärregime herrscht. Der die bürgerlichen Freiheiten beschränkende, politisch einflussreiche Islam hätte trotz der militärischen Niederlage nach dem schwarzen Jahrzehnt die Oberhand gewonnen.
Aube, die Hauptfigur, wirkt mit ihrem Schönheitssalon, den sie ausgerechnet gegenüber einer Moschee führt, ziemlich einsam. Keine Spur von Hirak, keine laizistische Jugend, die eine »neue Unabhängigkeit« fordert, und überhaupt: keine Freunde. Nur ein paar Prostituierte, oder Verrückte, oder was immer sie sind, die sogleich von der Polizei abtransportiert werden. Der algerische Alltag ist bedrückend; der Roman wird der Wirklichkeit wohl einigermaßen entsprechen. Im Zentrum der Misere sieht Daoud die Unterdrückung der Frau, ihre Unsichtbarkeit und Stimmlosigkeit.
Aube will den Frauen eine Stimme verleihen, doch paradoxerweise ist sie selbst stumm, erst am Ende gewinnt sie eine äußere, hörbare Stimme. Bei dem Mordangriff wurde sie zwar nicht getötet, der Gottesterrorist hat ihr aber die Stimmbänder durchtrennt. Daoud hat viele Merkmale seiner Hauptfigur von einer lebenden Person, Saâda Arbane, übernommen, die bei seiner zweiten Ehefrau, einer Psychiaterin, in Behandlung war. Saâda Arbane hatte lange vor der Publikation des Romans den Autor wissen lassen, dass sie eine Verwendung ihrer Geschichte, deren Details er nur durch seine Frau kennen konnte, nicht wünsche. In Algerien ist derzeit ein Rechtsstreit anhängig. Daoud, der seit über zehn Jahren eine »Fatwa« hat, lebt inzwischen mit seiner Frau in Frankreich. Sein mit dem Goncourt-Preis geehrtes Werk wurde von einem bekannten Kritiker als »feministischer Roman« bezeichnet. Dass dies zutrifft, ist aus mehreren Gründen zweifelhaft.
Huris wirkt als Romankonstruktion fragmentarisch, oft auch inkohärent. Die Grundhaltung der Hauptfigur ist zynisch, sie erwartet sich nichts, aber auch gar nichts von einer Gesellschaft, in der immer noch die Bärtigen das Sagen haben. Sie ist schwanger, aber ein Kind in diese Welt zu setzen, hält sie für einen Fehler. Trotzdem zögert sie mit der Abtreibung und ganz am Ende, im letzten, nachwortartigen Kapitel, schlägt ihre Häme in eine lebensfreundliche Einstellung um. Dies entspricht dem Programm, das Daoud im Roman entfaltet und in Interviews mehrfach bekräftigt hat. Überhaupt ist Huris eine Art Programmliteratur, die einige ideologische Überzeugungen illustriert. Überzeugungen, die im laizistischen Frankreich und darüber hinaus auf viel Gegenliebe stoßen. Huris ist eine komplexe Erzählmaschine, die durch viel Rhetorik und Realien, die nicht immer glaubwürdig erscheinen, zur Überhitzung tendiert. Trotzdem besitzt der Roman einen übergreifenden Handlungsbogen, gebildet durch die Frage, ob die »lächelnde« Stimmlose den achtwöchigen, also etwa erbsengroßen Fötus in ihrem Bauch abtreiben soll oder nicht. Zu ihm spricht Aube während des viertägigen Opferfests, bei dem zahllosen Lämmern die Kehlen durchgeschnitten werden. Huris ist ein einziger, mehr innerer als äußerer Monolog.
Der Titel bezieht sich auf die von westlichen Medien so gern aufgegriffenen Jungfrauen im islamischen Paradies. Aube nennt das Ungeborene »meine Huri«. Im Roman stellt sie die Leibesfrucht jenen anderen Huris gegenüber, die den »heldenhaften« – sprich: mordlustigen – Muslimen versprochen sind. Es ist dies eine der narrativen Konstruktionen, die man als kritischer Leser nicht unbedingt nachvollziehen mag. Aus literarischer Sicht ist das Problem dieses Romans weniger die Aneignung der Geschichte Saâda Arbanes als seine Überladenheit mit symbolschwangeren Motivketten und verblüffenwollenden Kontrasten wie auch Parallelismen in der Erzählkonstruktion. Am eindrucksvollsten sind letztlich die wenigen chronologisch und ohne viel Metaphorik erzählten Geschichten, etwa die einer Frau, die entführt und zwangsweise mit Terroristen verheiratet und zur Gebärmaschine gemacht wird; im Unterschied zu den männlichen Gotteskriegern wurde sie nie rehabilitiert.
Im Fazit erscheint Daouds Roman als rhetorisch-poetischer Versuch mit dokumentarischem Anspruch. Nicht Fisch und nicht Fleisch, haben die Konstruktionen oft nicht Hand und Fuß (beziehungsweise Flosse und Schwanz). Daouds rhetorische Kraft, wohl auch sein spürbarer Wille, ein großes Werk zu schaffen, halten erfahrene Leser trotzdem bei der Stange, und einiges über das Algerien der letzten 35 Jahre kann man hier durchaus erfahren. Andere Leser werden an der Mühe, sich durch dieses anspruchsvolle Werk zu ackern, scheitern.
Eine kürzere Version dieser Kritik erschien vor einiger Zeit im Magazin Falter.
© Leopold Federmair
