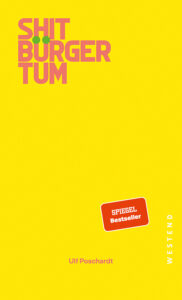
Shitbürgertum
Die Absage des Verlags zu Klampen machte erst recht neugierig. Was hatte Ulf Poschardt, der (damalige) Chefredakteur der Welt, ohnehin nicht bekannt für ausgewogene Formulierungen, bloß geschrieben? Schon der designierte Titel: Shitbürgertum. Poschardt machte nun etwas Außergewöhnliches: Er suchte sich keinen neuen Verlag, was ihm sicherlich ein Leichtes gewesen wäre, sondern gab sein Buch als Selbstpublikation heraus. Es liege »sehr billig in den Händen« schrieb mir ein Freund, womit Papier und Umschlag gemeint waren. Innen funkele es allerdings. Ich wartete auf das E‑Book bei Amazon. Ein paar Monate später nahm sich der Westend-Verlag der Sache an und Poschardt schrieb noch ein Kapitel zur inzwischen stattgefundenen Bundestagswahl 2025 dazu.
Mit dem Verlag im Rücken schaffte es das Buch bis auf Platz 3 der der Spiegel Bestsellerliste. Es gilt längst als Kult; man bietet sogar Kaffeebecher und Basecaps im Cover-Aussehen an. »Respekt muss man sich verdienen, Respektlosigkeit auch«, so Poschardt im »Vorvorwort« zum Titel. Weiter hinten erfährt man, dass ihn der argentinische Präsident Javier Milei dazu inspiriert habe. Der habe die Linke »Scheiße« genannt. Und danach eine Wahl gewonnen.
2016 entdeckte Poschardt schon einmal eine neue Gesellschaftsschicht und veröffentlichte ein Buch über das Geschmacksbürgertum. Die Zeit des Bildungsbürgers gehe zu Ende, so stand im Werbetext. »Bildung wird durch Geschmack ersetzt«. Was das genau bedeutet, ist schwer zu sagen; das Buch ist vergriffen und wurde nur wenig kommentiert. »Der Bürger strebt nach Schönheit, auch weil er sich selbst damit repräsentieren will«, schreibt Poschardt 2014 und deklamiert: »Der Kulturkampf ist vorbei.« Mindestens galt es für die Architektur.
Zehn Jahre später ist diese Episode, sofern es sie je gab, vorbei. Weg auch mit den halbwegs vornehmen Umschreibungen à la »links-liberal« oder »juste milieu«, vorbei der immer etwas dumme Spruch vom »Gutmenschentum« (wo sind denn die »Bösmenschen«?), mit dem man die sich moralisch und sittlich überlegen fühlenden charakterisierte. Dieses Milieu wird jetzt »Shitbürgertum« genannt. Überall finden deren Repräsentanten, moralinsaure Besserwisser, die ungefragt anderen Essens‑, Reise‑, Lektüre‑, Sprach‑, Mobilitäts- und Verhaltensimperative erteilen. Sie erklären Vegetarismus, autofreies Leben, antidiskriminierende Lektüre, gendersprachliche Formulierungen und CO2-neutrale Lebensweise nicht zu Empfehlungen, sondern machen sie zu Dogmen. Die Sache ist keineswegs so putzig, wie es den Anschein hat. »Als Disziplinarmacht im foucaultschen Sinne richtet das Shitbürgertum in seinen Berufen im Kultur- und Medienbereich, in Kirchen und NGOs, im vorpolitischen Raum und in den Parteien über Alltag und Leben der anderen«, so Poschardt. Vorbei die Zeiten, in denen man sich über Schlabberpulli-tragende Ökos in Sandalen noch amüsieren konnte. Das Shitbürgertum ist schleichend, aber deutlich an den Schalthebeln der politischen (und medialen) Macht angekommen. Der neueste Trick: Alles, was gegen die neuen Imperative in Stellung gebracht wird, als »Kulturkampf« zu deklarieren. Kulturkämpfer sind immer die anderen.
Die Folgen sind in allen Lebensbereichen spürbar. Der »oft regressive und infantile Moralismus« durchzieht Politik, Wirtschaft, Medien und Hochkultur. Schwerpunkte »der Trias der Unterdrückung und Umerziehung« liegen in der Kultur- sowie »Migrations‑, Klima- und Corona-Politik«. Das Shitbürgertum hat ein »Meisterwerk postheroischer Revolutionsdisziplin« errichtet, in dem man »weite Teile gesellschaftlicher Kommunikationssysteme erobert hat.« Poschardt zollt dieser Leistung durchaus Respekt und warnt, sie zu unterschätzen und mit Begriffen wie »woke« zu verniedlichen. Genial, wie das Shitbürgertum ein »Wir« erschaffen hat, um sich abzugrenzen. »Zur Beherrschung der Sprach- und Kulturkontrolle gehört zum Wir die Definition des Nicht-Wir und damit die Ausgrenzung – mithilfe zum Teil robuster Methoden der Denunziation und mit medialen Schauprozessen. Im Wissenschaftsbetrieb hat das zur stillen Immigration Andersdenkender geführt, Ähnliches geschah in ÖRR-Redaktionen und Kircheninstitutionen.«
Poschardt entwickelt nach dem Furor der beiden Vorworte einen kurzen Abriss der deutschen Geschichte nach 1945. Hier macht er den ersten Fehler, weil er versucht, große Teile der Nachkriegsgesellschaft, die sich rasch in der Mittelschicht wiederfand, sozusagen rückwirkend bereits zu Shitbürgern zu deklarieren. Sogar die Gruppe 47 bekommt ein eigenes Kapitel. Aber Shitbürger sind fast immer erst die Kinder der Boomer, der Nachkommen der Wirtschaftswunderbürger, die, wie er richtig bemerkt, über die zwölf Jahre des tausendjährigen Reichs großzügig hinweggesehen hatten (was ihnen von den Alliierten leicht gemacht wurde). Indirekt konzediert Poschardt dies selber, wenn er schreibt, dass es in der Bonner Republik zwar auch »Moralprediger« gab, die sich zum Teil dann als »verbeamteten Rebellionsdarsteller nach 1968« gerierten, aber bis 1989 war Deutschland weitgehend »austariert im rheinisch-katholischen Kapitalismus«, um dann »in verschiedenen Etappen nach 1990 im säkularprotestantischen Deutschland der Berliner Republik« überführt zu werden. Der vorläufige Höhe- bzw. Tiefpunkt stellt dann Angela Merkels Kanzlerschaft dar, in der die im »Wohlstand übermütig gewordenen Umerziehungsrigoristen des frühen 21. Jahrhunderts« vom Konservatismus unterstützt wurden.
Das Shitbürgertum ist »ökonomisch weitgehend ignorant, politisch heiter weltfremd, aber stets im Gestus geliehener Autorität, der Mehrheit der Gesellschaft den Weg weisen wollend.« Wobei, auch das wird thematisiert, die einheimische Gesellschaft längst nicht mehr ausreicht – inzwischen soll am deutschen Wesen wieder die Welt genesen, sei es in der Klima‑, Außen‑, Sozial‑, Flüchtlings‑, Wirtschafts- oder Geopolitik. Stets stehen Deutsche bereit, anderen ungefragt zu erklären, wie sie sich gefälligst zu verhalten haben.
Dabei zeigt ein Rückblick erstaunliches. Mit ihren »überheblichen politischen Urteilen« lagen die Moralprediger und Shitbürger fast immer »im Zweifelsfall falsch«, so Poschardt und zählt die Irrtümer auf: »Von der Wiederbewaffnung der Deutschen über die Westbindung über die soziale Marktwirtschaft über die Atomkraft über den NATO-Doppelbeschluss über die Friedensbewegung über die Wiedervereinigung…« Und Ulf Poschardt wäre nicht Ulf Poschardt, wenn er nicht auch die zeitaktuellen Problemfelder gleich mit kategorisieren würde, in denen das Shitbürgertum gelegen haben soll: »…über die Euro-Rettung über die Flüchtlingspolitik, über das Klimaregime über die Corona-Politik und über den Umgang mit dem kostbaren Gut der Meinungsfreiheit«.
Die Mitläufer des Shitbürgertums nennt Poschardt zunächst »Non-Player Character«, ein Begriff aus der Computerspielbranche, bezeichnend Teilnehmer, die nur passiv am Geschehen teilnehmen, Aber das genügt ihm nicht. Er hat einen Begriff gefunden, der bewusst despektierlich und beleidigend ist, vielleicht um schwankende Sympathisanten von der Agenda rot-grün-linker Gesellschaftsimperative abzuschrecken. Er nennt sie »Lauchbourgeoisie« (später nur noch »Lauch«). »Lauch« sind die Claqueure des Shitbürgertums, Mitmacher aus Überzeugung, aber vor allem in der Hoffnung, bei strukturellen Machtverschiebungen irgendwie zu profitieren. Ihr Biotop ist der Staat und die Institutionen, die von ihm im Form von NGOs finanziert werden, Hier fühlen sie sich wohl und können, bei entsprechender Führung, mitmachen. Wer zweifelt, wird verstossen. »Das Shitbürgertum hat eine Pädagogik der Angst entworfen, um diese Bourgeoisie loyal zu halten.« Zu dieser Angst gehört es, nicht nur den eigenen Machtverlust sondern auch konträre Meinungen zu politischen Themen stets als Katastrophe darzustellen.
Poschardts großes politisches Anliegen ist die Freiheit, etwas, was er in diesem Land zunehmend kaum mehr findet (die FDP, die er jahrelang offensiv, aber selten direkt publizistisch unterstützt hatte, spielt inzwischen bei ihm keine Rolle mehr). Daher seine starke Fokussierung auf Javier Milei, dessen Kettensägen-Programm, den Staat zurückzufahren, um die Kräfte des Unternehmertums und der gesellschaftlichen Freiheit jenseits von Regularien, Verordnungen und Gesetzen wiederzubeleben. Aber er begrüßt auch Mileis »Idee des Bürgers«, die »ganz nahe am Deutschen Idealismus in seiner rührenden Form« läge: »Kants mündigem Bürger und Hegels Verwirklichung der Freiheit des Willens.«
Milei fungiert auch noch als Konterpart zu Ortega, Castro oder Chávez, jenen Protagonisten aus Süd- und Mittelamerika, die einst von den Linken hoffiert wurden (eine sehr alte Rechnung, die hier präsentiert wird). »Freiheit ist nicht ein Salatdressing oder eine rhetorische Handcreme: Freiheit ist ein Treibstoff menschlicher Welteroberung und Neugier.« Er steigert sich ins Apologetentum eines Nihilisten, beruft sich auf Nietzsche und deklamiert: »Der aktive Nihilist…zerstört bestehende Werte, um Freiheit zu ermöglichen für Innovation und Neubeginn.« Interessant am Rande, dass in der Werbung zum Geschmacksbürgertum acht Jahre zuvor ebenfalls Nietzsche als Referenz genannt wurde.
Aktuell kommt noch Schumpeter als Vorbild für die »kreative Zerstörung« zu Wort. Poschardt hat keine Berührungsängste, sympathisiert unverhohlen für Trumps innenpolitischen Kurs. Sicherlich kann man sich über die Entrüstungen über Trumps gelungene PR-Inszenierung als Müllmann oder Kamala Harris’ statischen Wahlkampf amüsieren. Aber der Satz »Trump und Musk wirken wie freie Menschen« hat dann doch eher etwas pubertär-poesiealbumhaftes und wenn er dann noch Meloni und Netanjahu als weitere vorbildliche Freiheitshelden herbeiruft, wird es skurril.
Überhaupt muss man konstatieren, dass, sobald Poschardt philosophisch-historische Analogien zu Tocqueville, Nietzsche, (natürlich) Hegel und auch Heinrich Manns Diederich Heßling (um den deutschen Untertanengeist der letzten hundert Jahre zu illustrieren) bemüht, diese häufig ins Leere laufen. Poschardt ist kein Philosoph, nicht einmal Feuilletonist, sondern Leitartikler und Polemiker; eher Säbel statt Florett, bisweilen Gummihammer. Seine Diagnosen sind geschliffen, die Hiebe gegen die Bigotterien der Moralapostel/innen pointiert. Das von ihm so genannte Shitbürgertums kulturgeschichtlich abzuleiten, gelingt nur eingeschränkt überzeugend. Auch wenn er die Popkultur als Resonanzboden gegen die vom Shitbürgertum usurpierte »Hochkultur« in Stellung gebracht wird, geschieht dies meist nur als Gegenposition, um deren »Ambivalenzfreiheit« aufzuzeigen. Aber vielleicht wird der Kenner des Captain America-Universums mit Poschardts These, dies sei die »Pop-Antwort auf Ernst Jüngers Stahlgewitter und Leni Riefenstahls Triumph des Willens gewesen, etwas anfangen können. Ich bin da ‘raus.
Bei aller Milieukritik des »links-liberalen« fällt Poschardt natürlich nicht auf die Apologeten der Neuen Rechten herein. Er entdeckt allerdings Parallelen. »Der reaktionäre Wutbürger, der in der AfD sein nationalkonservatives Nest gefunden hat, nimmt es mit der Moral ähnlich genau«, heißt es einmal. Etwas gedrechselt die Pointe, die AfD sähe sich ähnlich dem Shitbürgertum als eine Art »Minderheitenbevollmächtigter«, und zwar »als Vertreter einer besonderen Minderheit, nämlich der der schweigenden Mehrheit.« Und so ist man in zunehmend Deutschland politisch heimatlos.
Der zweite Fehler von Poschardt ist sein zwischen den Zeilen bisweilen aufblitzender Triumph, dass das Shitbürgertum kurz vor dem Kollaps stünde. Zwar warnt er vor der Naivität, das Milieu zu unterschätzen, aber dann heißt es auch ganz vital, dass »die Safe Spaces für das Shitbürgertum« kleiner würden. »Die Realität bricht auch in die heile moralische Welt des Kulturbetriebs ein.« Er sieht, dass es »zu Ende geht mit der Monokultur des Shitbürgertums und seiner bornierten Engstirnigkeit.« Zwar habe es noch einen letzten Triumph im Wahlkampf 2024/25 gegeben, als man die Truppen noch einmal gegen »Rechts« versammeln konnte (gemeint waren die Demos gegen die Union, die eine Abstimmung mit der AfD in Kauf genommen hatte), während übrigens die antisemitischen Schläger auf den pro-palästinensischen Demos weitgehend ignoriert worden seien. Aber à la longue sieht Poschardt das Shitbürgertum in eine Art Diffusion.
Wie gesagt, so ganz scheint er seiner Prophezeiung nicht zu trauen. Im Erfolg der Linkspartei bei der letzten Bundestagswahl wird eine Radikalisierung des Shitbürgertums ausgemacht. Er hätte noch die Grünen anführen können, die mit dem Weggang einiger sogenannter »Realos« eindeutig nach links gedriftet sind. Der kleine Wahlerfolg der Union (unter 30%) betrachtet man dort als Interregnum. Das Shitbürgertum ist nicht angetreten, um sich im Mahlstrom eines Rollback absorbieren zu lassen. Die Hegemonie linksgrüner Politik wird nicht zuletzt mit Hilfe der öffentlich-rechtlichen Leitmedien weiter geführt. Hier tummeln sich die Sympathisanten besonders.
Ein Weg zurück zur Macht könnte unter anderem im Durchsetzen eines AfD-Verbots liegen. Dies würde zumindest zeitweise in einigen Parlamenten zu linken Mehrheiten führen. Bis dahin müssen Konvergenzen zwischen Union und AfD entdeckt und womöglich auch konstruiert werden. Poschardt schreibt das nicht. Nur kurz widmet er sich der »Brandmauer«-Debatte und konstatiert, dass es auf der linken Seite eine solche Mauer nie gegeben habe. Insgesamt erscheint mir Poschardts Abgesang als zu früh und der Begriff »Shitbürgertum« insgesamt zu unernst gewählt.

Die feuilletonistische Streitschrift enthält viele gute intuitive Ansätze, aber ist natürlich auf der theoretischen Ebene beschränkt. Trotzdem würde man das gerne lesen, weil die »neue Unheimlichkeit« jederzeit mehrere konkurrierende Erklärungen verträgt.
Ich habe die Rezension mit der Referenz auf die »normopathische Gesellschaft« und den »normopathischen Charakter« von Hans-Joachim Maaz gelesen. Das sind die Leute, die man früher die Tausend-prozentigen nannte. Es ist erstaunlich, wie viel an Deckung man dabei erhält. Den sarkastischen Begriff des Shitbürgertums kann man sinnbewahrend tatsächlich mit dem Begriff Normopathie ersetzen. Schon mal bemerkenswert. Wir reden von derselben Sache!
Historisch kann man das natürlich zurückprojizieren, wird aber keinerlei Erkenntnisvorteile gewinnen. Irrelevant, würde ich sagen. Die hartnäckige Verblendung von Politik und »Kultur« gibt da schon eher zu denken. Ständig auf zwei Ebenen gleichzeitig zu verhandeln... Mannomann. Ich denke, hier kommt das Problem der »Quadratur« zum Vorschein, das Poschardt mit einem beherzten Griff zum aktiven Nihilismus beantwortet. Eine etwas verzweifelte Großtat. Stimmt, die Aufgabe ist bizarr und beinahe unmöglich: wie bekämpft man ein Personal, das sich erfolgreich dem Zugriff einer abgestuften Verantwortlichkeit entzogen hat, und nur noch die Klaviatur der Macht kennt, und die eigene Überladenheit ständig in Stellung bringt?!
Ich muss gestehen, dass mir die Paradoxien schon noch viel Sorgen machen. Ich sympathisiere bereits mit der moralischen Sezession, einer weltanschaulichen Skepsis. Die Aufstellung von Gegenkandidaten wie bei einem Elefantenrennen ist natürlich verführerisch, aber man weiß, wie lange solche Illusionen reichen. Trump?! Milei?! Naja. Richtig ist, dass die normopathischen Kräfte jetzt eine Gegenmacht zu gewärtigen haben. D.h. unsere Kulturkämpfe sind tatsächlich ein richtiges Momentum geworden, jenseits des »Realen«, aber trotzdem echt, d.h. sie haben einen Effekt bei den Wahlen, bzw. der Entwicklung der Parteien. Ist doch interessant, dass die linken Parteien schon wieder ihre Prinzipienhaftigkeit steigern möchten (...geht das?!), während die Rechtspopulisten in die Mitte streben (...auch nicht leicht!). Eine interaktive demokratische Kultur gibt es nicht, wie es scheint. Es war wohl immer nur ein Kraftakt der guten Manieren.
Vielen Dank für den Kommentar. Maaz kannte ich nicht. Und man stelle sich einmal vor, Poschardt hätte den Begriff der »normopathischen Gesellschaft« versucht, zu popularisieren. Kein Mensch hätte dieses Buch gekauft.
Ich hatte parallel einen Roman von Aurélien Bellanger mit dem hübschen Titel Die letzten Tage der Linken gelesen. Hier geht es um die sozialistische Partei Frankreichs und das Ringen der politischen Parteien dort um Begriffe wie Laizismus und Gleichheit und natürlich auch um die identitätspolitischen Diskussionen. Der Roman dockt an realen Personen an, die aber verfremdet werden und hat in Frankreich – wie erwartet – Kontroversen ausgelöst. Vergleicht man nun die politischen Kämpfe hier und dort stellt man fest, dass es unterschiedlicher gar nicht sein könnte (was natürlich auch mit der Regierungsform zusammenhängt). Ein entscheidender Unterschied scheint zu sein, dass in französischen Massenmedien (Talkshows) Philosophen sitzen und dort diskutieren, während bei uns bräsige Journalistendarsteller und das politische Personal dominiert. In Frankreich ist zudem die politische Rechte »normal« geworden; sie wird politisch bekämpft und nicht mit Haltungsintellektuellen. Dennoch gibt es auch dort zunehmend normopathische Auswüchse. Zur Bändigung dieser entwickelt sich dort allerdings eher weniger Trump- noch Milei-Fantum.
Doppelshit. Zwischen Skylla und Charybdis. Ob wir da nochmal durchkommen?