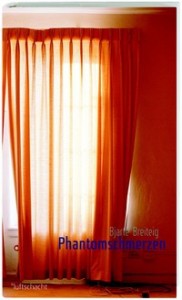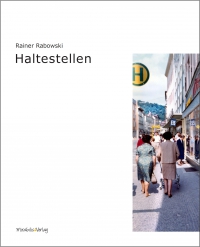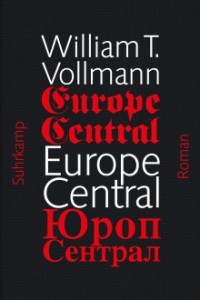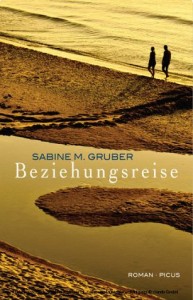Bucheli vs Weidermann – der Ausgang steht leider fest.
Als ich Roman Buchelis Artikel »Ein Leben nach dem Papier« über die »Literaturkritik unter Druck« vor einigen Wochen las, überlegte ich mir, ob es eine Reaktion aus dem Feuilleton geben wird. Im Allgemeinen reagiert das etablierte Feuilleton auf Kritik mit der wirkungsvollsten Waffe, die man zur Verfügung hat: Man ignoriert sie. Der allseits so beschworene Diskurs gilt nur in einem hermetischen Raum. Selbstreflexion ist dort eher nicht vorgesehen. Stattdessen igelt man sich lieber ein und verkündet trotzig auf dem richtigen Kurs zu sein. Allenfalls wird noch sinkende die finanzielle Ausstattung moniert. Das zurückgehende Interesse beim (potentiellen) Publikum wird als Kultur- und Zeitgeistkritik behandelt. Insbesondere wenn es um das Internetangebot von Tages- oder Wochenzeitungen geht, ist die Publikumsbeschimpfung fast immer der Weisheit letzter Schluss.
So weit, so gut. Buchelis Artikel war aber das Gegenteil der sonst üblichen Larmoyanz. Er beginnt mit eine nüchternen, ja ernüchternden Bestandsaufnahme: »Redaktionen können, um es zugespitzt auszudrücken, genau jene Zeitung produzieren, die der Werbemarkt zulässt.« Zu abhängig sei man von Anzeigen vor allem der großen Verlage, so suggeriert er. Also müsse man auch die beworbenen Bücher rezensieren. Dabei beschreibt er den Rezensenten als »hybride[s] Wesen« und »Diener verschiedener Herren« – Verlage, Autoren, Redaktion, Leserschaft: alle wollen etwas von ihm (ihr), aber die Interessen sind nicht nur divergierend, sie widersprechen sich unter Umständen sogar. Da aber die ökonomischen Zwänge dominant werden, wird die Rezension am Ende als eine Art »Gratiswerbung« angesehen – selbst ein deftiger Verriss ist gerne gesehen. Für Tiefe gebe es weder Zeit noch Raum im Blatt.