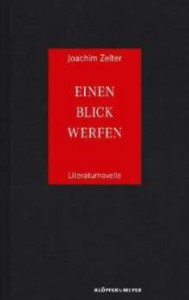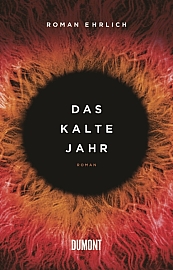
Wenn man den Sound der Lesung zum Bachmannpreis Mitte Juni noch im Ohr und Kopf hat, dann gibt es jetzt bei der Lektüre von Romans Ehrlichs Roman »Das kalte Jahr« lauter kleine ein Déjà-vu-Erlebnisse. Tatsächlich besteht der Text, den Ehrlich in Klagenfurt vorgelesen hatte, aus sechs verschiedenen Stellen im Buch (die Seiten 91–94, 100f, 24f, 112–114, 97, 127ff), die geschickt montiert wurden. Ein namenloser Ich-Erzähler lebt im Haus seiner Eltern in einem nicht näher bezeichneten Küstenort. Dort wohnt überraschenderweise wie selbstverständlich ein ihm unbekanntes (etwa 12jähriges) Kind mit dem Namen Richard. Die entscheidenden Fragen (Wo sind die Eltern? Was macht er in dem Haus?) bleiben aus einer Art Rücksichtnahme gegenüber dem Kind unbeantwortet; Richard wird bereits bei Andeutungen nervös. Der Ort zeichnet sich durch eine durchdringende, dauerhafte Kälte mit zumeist exzessivem Schneefall aus. Das Tageslicht ist nur eine etwas hellere Dämmerung. Lebensmittelpunkt im Haus ist ein Ofen, der mit Holt geheizt wird. Um Geld zu verdienen, begibt sich der Erzähler in die Elektrowerkstatt des Ortes. Problemlos wird er eingestellt und damit beauftragt, aus den aus dem Äther gefischten Fernsehsignalen (schlechtes Bild; kaum Ton) ein Programm aufzuzeichnen und zusammenzustellen, das sich die Bewohner am nächsten Tag gegen eine geringe Gebühr auf Kassette ansehen können. Abends trägt der Erzähler Richard Geschichten vor. Es sind Geschichten von Naturkatastrophen, Verbrechen, Hinrichtungen oder einfach nur Schicksalen, insbesondere aus dem 19. oder 20. Jahrhundert aus den USA.