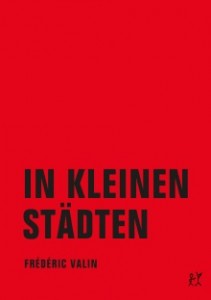Vortrag vom 2. November 2013 beim Symposium »Interkulturalität in der Literatur – regionale, nationale und kontinentale Identitäten«, Städtische Universität (Shiritsu Daigaku) Nagoya/Japan
Ich bin ein Migrant. Seit elf Jahren lebe ich in einem Land fern von meinem Geburtsort, davor habe ich in vier anderen Ländern dauerhaft gewohnt, und auch die Jahre in Wien waren für mich als überzeugten Westösterreicher ein Auslandsaufenthalt, übrigens der unangenehmste von allen. Wo ich den Lebensabend verbringen werde, wo ich begraben sein möchte? Keine Ahnung. Vielleicht »zu Hause«, vielleicht nicht. Meine Wanderungen sind noch nicht beendet.
Migrant zu sein ist nichts Besonderes, heutzutage eher die Regel als die Ausnahme. Eine Lebensform, mit der viele Menschen auf die eine oder andere Weise Bekanntschaft geschlossen haben. Insofern ist auch »Migrantenliteratur« nichts Besonderes. Man wird sogar sagen können, daß die Literatur mit ihrer alten und notorischen Neugier für alles Fremde das, was heute der gesellschaftliche Regelfall ist, vorweggenommen hat. Im Grunde beruht die Rede von den Migranten mit ihrem Hintergrund und ihrer Kultur nur auf einer bestimmten Sichtweise. Die Wurzeln der Migration gehen weit, sehr weit zurück. Ebenso das Phänomen der Globalisierung. Wann hat sie begonnen? Mit Kolumbus? Mit der Hanse? Mit Odysseus? Mit den Argonauten? Als ich in den siebziger Jahren Germanistik studierte, war Exilliteratur ein Modethema. Das Exil aber ist nur eine besondere Art der Migration, wie Sevgi Özdamars Roman Die Brücke vom Goldenen Horn sinnfällig macht.
Vor einigen Jahren wurde ich von einer Literaturzeitschrift um einen Beitrag für ein Heft zum Thema Reiseliteratur gebeten. Ich sagte zu und hatte ein ungutes Gefühl, weil ich mich nicht als Reiseschriftsteller betrachte. Meistens bin ich nicht auf Reisen, sondern lebe woanders (als in meinem Herkunftsland) und bewege mich zwischen verschiedenen Orten, weil ich dort etwas zu tun habe, etwas suche, Freunde treffen will, mich in eine Frau verliebt habe, an einem Kongreß teilnehme, mit einem Autor über ein zu übersetzendes Buch sprechen will. Der Reisende im herkömmlichen Sinn hat seine Rückkehr eingeplant. Das ist bei meinem Migrantentum – meiner vielfältigen Wanderschaft – oft nicht der Fall. Manchmal sage ich, um einen Gesprächspartner zu verblüffen: Ich reise nicht gern. Und füge, wenn die Verblüffung aufgebraucht ist, hinzu: Ich halte mich gern an verschiedenen Orten auf, aber ich bin nicht so gern unterwegs. Mein Ideal wäre die Ubiquität. Semper et ubique. Den Körper beamen, nicht nur den Geist und die Bilder (was durch die kommunikationstechnische Entwicklung sehr erleichtert worden ist). Reisen ist mir auf die Dauer zu anstrengend.
Weiterlesen ...