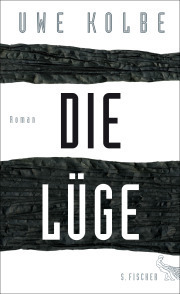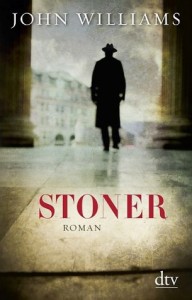Das menschliche Gesicht
Was mir heute, viele Jahre später, in einem Vorüber aufgeschnappt und fortentwickelt aus einem Tonfetzen, plötzlich wieder im Ohr ist, ist die Musik einer englischen Band namens Doll by Doll. Im Stück The human face die berühmte Artaud-Zeile the human face is an empty power, it is a field of death.
(Nach etlichen Artaud-Lektüren kommt es mir vor, als wäre das – wohl durch sein durch Theater-Denken – eine der spezifischen Kräfte Artauds gewesen: Soziale Abstraktheiten kurzzuschließen in der drängenderen Physiologie. Und das um damit womöglich auch zur Gestalt seiner eigenen Erkrankungen vorzudringen, der er viele Jahre unter nervösen Körperqualen litt und deshalb in psychiatrischen Kliniken überdauerte. Aber vielleicht ist ja jegliche Idee immer auch ein bisschen Wahn.)
Diese englische Band jedenfalls hatte ich irgendwann einfach vergessen. Sie schien damals schon, Anfang der 80er, ein bisschen neben der Zeit (die für mich eine vor allem von Joy Division dominierte war). Aber dieses Stück war eine eklektisch-kluge, für die erschöpften Rock Musik-Verhältnisse seinerzeit sogar kunstvolle Nummer, eine merkwürdige Bricolage auch (statt dem heute oft bewusst unorganischen, stattdessen an die Ideen seiner jeweiligen Quellen appellierenden Samplings): Sogar ein Jesus Saves-Chor kommt darin vor – und es ist nicht peinlich!
Und noch zu diesem Satz von Artaud: Ich weiß nicht mehr, was genau ich mir dabei gedachte hatte, als ich, früher Artaud-Leser, schon vorher immer wieder die Zeilen bei mir gehabt hatte und in dem Song dann wiedererkannt hatte. Antonin Artauds Die Nervenwaage stand im Bücherregal meines Vaters, und immer wieder, seit ich mit dem ernsthaften Lesen angefangen hatte, war ich zu diesem Buch zurückgekehrt, weil eben das Unzugängliche der Texte, deren vermeintliche Verrücktheit, längst etwas in mir geöffnet hatte.
Weiterlesen ...