Um diese Bücher geht es:
Laura Freudenthaler: Arson
Charles Ferdinand Ramuz: Sturz in die Sonne
Roy Jacobsen: Die Unwürdigen
En détail:
Warum der Hollywood-Film »Oppenheimer« den japanischen Kinozusehern vorenthalten wird
In allen Weltgegenden konnte man während der letzten Wochen den Hollywood-Film Oppenheimer sehen, außer in Japan, also auch nicht in Hiroshima, der Stadt, die die Auswirkungen der von Robert Oppenheimer koordinierten Erfindung namens Atombombe als erste und am härtesten zu spüren bekam. Es gibt das Gerücht, daß der Film aus Japan verbannt bleiben soll; wahrscheinlicher ist, daß man ihm hier keinen großen Erfolg zutraut und ihn später in Programmkinos zeigen wird. Kommentare zum Film können wir im Internet jedoch lesen, sogar ein dreiminütiger Trailer ist uns vergönnt. In diesem sieht man eine Explosion, einen wunderschönen roten, abstrakt bleibenden Feuerball, der den ganzen Raum hinter der Figur ausfüllt. Dem Vernehmen nach läuft die Explosionspassage in dem sonst anscheinend überlauten Film ohne Ton ab. So kann man das Spektakel umso ruhiger genießen. Christopher Nolan, der Regisseur, hat diese Szene als »showstopper« bezeichnet, er wollte sie nicht mit Computeranimation drehen. Das Publikum sollte an dieser Stelle, wenn schon nicht applaudieren, dann zumindest wow! flüstern. »Heller als tausend Sonnen«, schrieb Robert Jungk in den fünfziger Jahren, als Robert Oppenheimer von den Kommunistenjägern verfolgt wurde.
Manohla Dargis, Kritikerin der New York Times, fand es gut, daß der Film die realen Wirkungen der beiden ersten Atomangriffe ausspart. Um ihr Argument zu untermauern, zitiert sie François Truffaut, der meinte, jeder Kriegsfilm, auch Antikriegsfilme, würden den Krieg glorifizieren. Truffaut bezieht sich allerdings auf Spielfilme, in denen Soldaten beim Kriegshandwerk gezeigt werden. Ich glaube nicht, daß er sagen wollte, jede Dokumentation würde den Krieg verherrlichen. Dann wäre auch das Friedensmuseum auf dem Ground Zero in Hiroshima, wo die erste der beiden Bomben explodierte, bloß ein unerhebliches Element der globalen Tourismus- und Unterhaltungsindustrie. Ist es aber nicht, trotz der Einwände, die man nach der kürzlich erfolgten Renovierung des Museums erheben kann. Und trotz des gleich hinter dem einzigen damals – als Skelett – stehengebliebenen Gebäude, dem sogenannten Hiroshima-Dome, errichteten Orizuru-Buildings, wo Touristen gegen ein nicht ganz geringes Entgelt selbstgefaltete Kraniche von der obersten Etage segeln lassen und Souvenirs einkaufen dürfen. Ein Besuch des Friedensparks und des Museums weckt immer noch in jedem nicht ganz gefühllosen Besucher Abscheu gegen den Krieg, besonders gegen den Atomkrieg. Und daß die Einzelschicksale der damals im Feuerball Verbrannten, Verschmolzenen und Verstrahlten ins Zentrum der Ausstellung gerückt werden, die historischen Zusammenhänge einschließlich japanischer Kriegsschuld aber im Hintergrund bleiben, ändert an dieser Betroffenheit gar nichts, im Gegenteil. Ein Rückgriff auf historisches Dokumentationsmaterial hätte zwar keinen Showstopper-Effekt im Oppenheimer-Film gebracht, aber den Ernst der Angelegenheit unterstrichen. Mag sein, daß solch krude, schmerzerregende Bilder die wohldurchdachte Erzählästhetik des anscheinend rundum gelungenen Films gestört hätten.
Auch ohne – aus dem erwähnten Grund – Nolans Film gesehen zu haben, könnte man den Glorifizierungsverdacht ebensogut gegen diesen wenden. Dem Vernehmen nach ist nach dem sogenannten Trinity-Test im Juli 1945, also der ersten gelungenen Atomexplosion, die Freude der Forscher und Entwickler angesichts des Feuerballs zu sehen. Wird hier die atomare Zerstörung glorifiziert? Vielleicht nicht. Dem Kritiker der britischen Filmzeitschrift Empire jedenfalls dreht sich an dieser Stelle der Magen um. Wenig später spricht derselbe Autor allerdings von der »IMAX-boosted« Schönheit der Trinity-Sequenz und findet sie »umwerfend«. Letztlich wird die Atomerzählung wohl von der Ambivalenz und den Zweifeln getragen (oder gerettet?), die Cillian Murphy – wieder dem Vernehmen nach – an der Figur Oppenheimers aufzuweisen versteht.

Stephan Lamby ist seit einer gefühlten Ewigkeit der Chronist bundesdeutscher Innenpolitik. Man erinnert sich noch an sein fast legendäres Interview mit Helmut Kohl und die zahlreichen, zeitgeschichtlich bedeutenden und mehrfach prämierten Dokumentationen insbesondere in der endlos erscheinenden Merkel-Ära, die in schöner Regelmässigkeit und zeitnah in der ARD zu sehen waren. Immer wieder zeigt er Menschen, die politische Macht auf Zeit haben, bei ihren Versuchen, im Widerstreit zwischen Freund und Gegner, Medien und Öffentlichkeit für ihre Ideale zu agieren und dabei nicht selten gehetzt und getrieben erscheinen (manchmal kommentieren zusätzlich Journalisten). Zum fast geflügelten Wort wurde der Titel seines Films über die »nervöse Republik«. Die politischen Protagonisten erlaubten ihm Einblicke, die anderen verborgen bleiben. Im Gegensatz zu anderen Filmemachern, die sich wuchtig inszenieren, ist Lamby ein Politikflüsterer; in seiner zurückhaltenden, manchmal fast antichambrierenden, dabei jedoch nie unterwürfigen Art gelingen bisweilen bemerkenswerte Einsichten.
Dabei formuliert Lamby mit seiner sanft-einnehmenden Stimme durchaus Hypothesen. Noch häufiger als in einem Film sind solche unterschwelligen Bewertungen in Büchern spürbar. Und damit kommt man auf Stephan Lambys neuestes Buch Ernstfall – Regieren in Zeiten des Krieges. Der Untertitel lautet ein bisschen amerikanesk »Ein Report aus dem Inneren der Macht«. Damit wird eine gewisse Erwartung geschürt. Und Lamby lässt sich nicht lumpen.
Auf fast 400 Seiten wird das Wirken und Handeln der neuen Bundesregierung vom Dezember 2021 bis zum 13. Juli 2023 (NATO-Gipfel in Vilnius) beschrieben. Dabei stehen zwei Themen im Vordergrund, die sich teilweise gezwungenermaßen überlagern. Zum einen die Invasion Russlands in die Ukraine vom 24.2.22, die sich rasant verändernden Parameter der Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands und die Auswirkungen auf die Energieversorgung eines der größten Industrienationen der Welt. Und zum anderen die Bemühungen um eine ökologische Transformation des Landes im Angesicht des bedrohlichen Klimawandels.
Alle anderen Themen, wie etwa der frühe Rücktritt von Anne Spiegel, die sehr umstrittene Wahlrechtreform oder, noch einschneidender für die Bevölkerung, die »Abwicklung« der Covid-Pandemie nebst dem Debakel, eine Impfpflicht zu implementieren, werden ausgeblendet. Fast ein bisschen pflichtschuldig wirkt eine Erwähnung mit und über Karl Lauterbach, der in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine plötzlich kaum noch in den Schlagzeilen steht. Dabei war gerade das Thema Impfpflicht eine höchst kontroverse Angelegenheit; quer durch alle Fraktionen.
Natürlich muss Lamby Prioritäten setzen. »Zeitenwende« und ökologische Transformation sind die Themen, die Deutschland noch lange beschäftigen werden. Wer im Februar 2022 auf eine einsame Insel ohne Medienzugänge verschlagen wurde und heute, anderthalb Jahre später zurückgekommen ist, kann mit diesem Buch seine Informationsdefizite rasch und, was diese Themen angeht, umfassend auffüllen. Weitgehend wird chronologisch, zeitweise tagebuchartig erzählt. Nur ab und zu gibt es Zusammenfassungen. Dabei vermeidet Stephan Lamby dankenswerterweise weitgehend die mittlerweile grassierende Reporterunsitte, seine Beobachtungen als Literatur zu verkleiden.
Nach Karlmann (2007) und Vaterjahre (2014) legt Michael Kleeberg nun mit Dämmerung den dritten (und letzten) Band der fiktiven Biographie von Karlmann Renn, genannt Charly, vor. Charly, Jahrgang 1959, erlebte in Karlmann die Zeit zwischen 1985 (es beginnt mit Boris Beckers erstem Wimbledon-Sieg) und September 1989. Vaterjahre spielt zwar nur an zwei Tagen (10.9.–11.9.2001), fasst ...
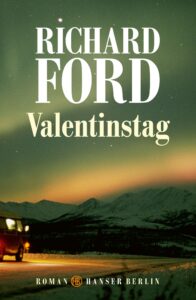
Da ist er also wieder: Frank Bascombe. Inzwischen 74 Jahre, sechs Jahre älter als bei den Erzählungen von Frank, die allerdings 2012 spielten, während der Hauptteil des neuen Romans Valentinstag 2019/2020 spielt. So ganz stimmt da was nicht (oder ich habe falsch gerechnet).
Seine erste Frau Ann, Mutter seiner Kinder Paul (47) und Clarissa (45), ist verstorben (sie litt an Parkinson). Frank selber ereilte in der Zwischenzeit ein »Mini-Schlaganfall« sowie »eine Episode globaler Amnesie und ein kleines, frisch entdecktes Loch« im Herz. Zuweilen tritt noch der (bekannte) Schwindel auf, aber ansonsten geht es ihm gut. Er hat in Haddam einen Teilzeitjob als »Hausflüsterer« bei seinem früheren Angestellten Mike Mahoney angenommen. Frank sitzt alleine in einem Büro, bewundert, was aus Mike, dem Tibeter, geworden ist und kümmert sich um Immobilienbeschaffung für Leute, die nicht in Erscheinung treten wollen. Potentielle Kunden leitet er dann an seinen Boss weiter, der sie wiederum in seinem kleinen Firmenimperium weiterbearbeitet.
Die Tage sind lang und so kommt Frank ans Räsonieren und Bilanzieren über Vietnam, seine Mutter, seine zweite Frau Sally, die als weltweite Trauerbegleiterin derzeit in Tschetschenien weilen soll oder einen gewissen Pug Minokur, der sich irgendwann einmal während seines kurzen Aufenthalts auf der Militärakademie für ihn beim Basketballtrainer eingesetzt hatte. Als sei es eine Verpflichtung, erzählt er ihm Jahrzehnte später auf einem Veteranentreffen davon. »Ich dankte ihm – für lebenslange Erinnerungen. Ich ergriff seine erstaunlich weiche, erstaunlich kleine und einst geschickte Hand – seine Werferhand – und schüttelte sie behutsam, um der guten alten Zeiten willen.« Teil eines Programms, »bevor der graue Vorgang fällt«. Ob Pug sich daran erinnert – egal.
Schließlich nimmt er sich frei, um den letzten Wunsch von Ann zu erfüllen, dass »die Hälfte ihrer kremierten Überreste auf dem Friedhof von Haddam neben unserem Sohn Ralph Bascombe begraben werden sollte, der jetzt einundfünfzig wäre und ein berühmter Physiker an der Cal Tech oder ein Lyriker oder ein viel bewunderter Solo-Oboist.« Und so reist er mit einem Zipper-Beutel im Flugzeug zu einem einstigen Familienidyllenort mit »Urkiefern und ‑tannen«, »drehte den Beutel um und ließ den körnigen Inhalt hinausrieseln.«
Dominik Graf und Anatol Regnier untersuchen Motive und Befindlichkeiten von Schriftstellern, die während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland geblieben waren.
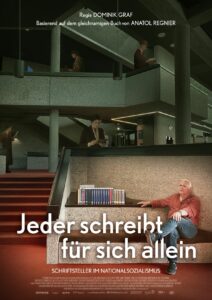
Seit fast 50 Jahren macht Dominik Graf Filme. Viele Fernsehspiele sind darunter, Krimis, Tatorte und Polizeirufe aber auch Dokumentar- und Literaturverfilmungen. Er ist einer der letzten Regisseure, die Fernsehproduktionen noch mit einem gewissen Anspruch ausstatten. Sein neuer Dokumentarfilm sprengt nicht nur hinsichtlich Thematik sondern vor allem wegen seiner Länge die »normalen«, scheinbar unhinterfragbaren Fundamente zeitgenössischen Fernsehschaffens. Einhundertsiebenundsechzig Minuten, also fast drei Stunden, dauert Jeder schreibt für sich allein und er zeigt Leben und Auskommen deutscher Schriftsteller, die während der NS-Zeit im Land verblieben waren.
Das Gerüst liefert das 2020 von Anatol Regnier publizierte Buch gleichen Titels. Regnier, 1945 geboren, ist der Sohn des Schauspielers Charles Regnier (bekannt aus zahlreichen Serien und Fernsehfilmen, aber auch als Komödiant) und Pamela Wedekind, der Tochter des Dramatikers Frank Wedekind und der Schauspielerin Tilly Newes. Anatol Regnier verfasste neben anderen Büchern 2008 eine vielbeachtete Biographie über Frank Wedekind.
In unterschiedlicher Intensität kreisen Buch und Film um das Verhalten von Gottfried Benn, Erich Kästner, Hans Fallada, Jochen Klepper, Hanns Johst, Ina Seidel und Will Vesper während der Zeit des Nationalsozialismus. Auf Börries von Münchhausen, Hans Grimm oder Agnes Miegel, auf die Regnier in seinem Buch näher eingeht, wird im Film verzichtet.
Im Film kommentieren die Eindrücke und Thesen unter anderem Florian Illies, Albert von Schirnding, Christoph Stölzl, Gabriele von Arnim, Julia Voss und Günter Rohrbach, der eine Sonderstellung einnimmt. Der inzwischen 94jährige Nestor des deutschen Qualitätsfernsehens erzählt im letzten Drittel in zwei Exkursen von seiner Kindheit und Jugend im saarländischen Neunkirchen. Ansonsten »moderiert« Anatol Regnier den Film als eine Art Erzähler; häufig im Gespräch mit Dominik Graf. Die ruhige, bisweilen anekdotische, aber niemals triviale Erzählweise des Buches wird behutsam auf den Film transferiert. Häufig wird ein Split-Screen eingesetzt, der das Gesagte mit Original-Bildern oder Filmsequenzen ergänzt und verdichtet. Ansonsten bleibt die Konzentration auf das Wort.

Der Anfang weicht vom Buch ab. 1945 versuchte der amerikanische Psychologe Douglas McGlashan Kelley mit Gesprächen und, das war neu, Rorschach-Tests den Seelenzustand der in Nürnberg angeklagten Nazi-Größen zu analysieren. Kelley suchte, wie es ein bisschen pathetisch heißt, »das Böse im Menschen«. In 22 cells in Nuremberg präsentierte er 1947 die Ergebnisse seiner Gespräche. Für die Analysen der Rorschach-Tests konsultierte er Fachleute und Experten. Aber deren Auswertungen wurden entgegen der Absichten nie veröffentlicht. Später hat es geheißen, man habe nicht das gefunden, was man erwartete. Diese Männer – gemeint sind die Kriegsverbrecher – wären keine »wahnsinnigen Kreaturen« gewesen; Neurotiker hätten sich darunter befunden aber auch einfach nur Opportunisten; eigentlich, und das ist das erschreckende, handelte es sich um »normale« Menschen.
Andrea Giovenes Haus der Häuser, Band drei der Autobiographie des fiktiven Giuliano di Sansevero, endet im Juni 1940 mit dem Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg, von dem die Hauptfigur während einer Zugfahrt überrascht wurde. Licudi, der Zauberort am Meer, in dem die Welt stillstand, war von Touristen, Immobilienspekulanten und Archäologen eingenommen, die Beschaulichkeit zerstört ...
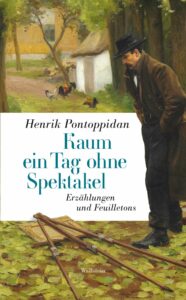
Im letzten Jahr beendete Ulrich Sonnenberg seine Arbeit an der Neuübersetzung der variantenreichen Himmerlandgeschichten des dänischen Nobelpreisträgers Johannes V. Jensen. Und nun liegt im Wallstein-Verlag mit Kaum ein Tag ohne Spektakel eine Anthologie eines anderen dänischen Autors vor: Henrik Pontoppidan (1857–1943), Sohn eines Pfarrers und 1917 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Zusammen mit Marlene Hastenplug fungiert Sonnenberg hier als Herausgeber. Die Übersetzungsarbeit der zwischen 1881 und 1918 in diversen Publikationen erschienen Texte wurde von insgesamt zwölf Studentinnen und Studenten des Instituts für Skandinavistik in Frankfurt vorgenommen1. Neben zwölf Erzählungen wurden acht Feuilletons aufgenommen. Das Nachwort ist von Nils Gunder Hansen, Leiter des Pontoppidan Centers der Süddänischen Universität in Odense. Hier wird ein sehr instruktives Webportal zu Henrik Pontoppidan betrieben, auf dem sich Texte des Dichters im Original, aber auch auf Deutsch zu finden sind.
Hansen weist in seinem Nachwort kurz auf die epischen Romane Pontoppidans hin (die im übrigen in deutscher Übersetzung nur ungenügend lieferbar sind) und den auch in Dänemark virulenten Wunsch nach dem umfassenden Gesellschaftsroman (das scheint überall und zu allen Zeiten ein Verlangen zu sein), um dann den Fokus auf die ausgewählten Texte zu richten. Man lernt, dass der Erstkontakt mit Pontoppidan im Schulunterricht in Dänemark durch die Erzählungen Ane-Mette und Gnadenbrot hergestellt wird. Ane-Mette spielt auf einem dörflichen Friedhof, eine Viertelmeile entfernt vom (fiktiven) Ort Lillelunde (den Pontoppidan in mehreren Erzählungen verwendet). Der Kirchhof ist »nackt und unheimlich«, die Vogelstimmen bilden gegen Abend ein »Höllenkonzert«, was im Kontrast zu den bunten Tönen der Bäume im Herbst steht. Aber es ist Sommer und warm und es geht um eine Person, eine Frau, die in Trauerhaube auf einer Bank sitzt. Später erfährt man, dass sie noch in Begleitung eines zwölfjährigen Mädchens ist. Die Trauerhaube trägt die Frau nicht wegen ihres vor vier Jahren an einem »glücklichen Wintermorgen« dahingeschiedenen Mannes (einem Trunkenbold). Sie ist dort, weil ihre vor zwanzig Jahren verstorbene, damals dreijährige Tochter, von zwei Männern exhumiert wird, weil genau an dieser Stelle ein Kind einer reichen Familie begraben werden soll. Die beiden Männer beeilen sich, aber die Aktion wird erschwert, weil man noch unverhofft die Gebeine eines Mannes findet, der auf dem Kind bestattet worden ist. Erst dann sammelt man die Kinderknochen auf und es gibt sogar noch eine Haarlocke von jener Ane-Mette. Die prunkvolle und gesangreiche Beerdigung der Reichen nutzt die Frau als Hintergrund, um die Überreste ihres Kindes in einem Rasenstück mit der Würde zu beerdigen, die ihr damals nicht möglich war. »Sie fühlte sich so leicht ums Herz…so wie jemand, der eine alte Schuld beglichen hat…«
Gnadenbrot erzählt von einem neu gebauten »Armen- und Arbeitshaus«, in dem sich die »verbrauchten Kräfte« versammeln, »wenn die Hand zu schwach und der Rücken zu krumm wird, um die Last des Lebens noch lange zu tragen.« Die Schilderung der Opulenz des neuen Bauwerks kontrastiert mit der sarkastischen Schilderung der Verbringung jeder »erschöpften Existenzen« und ihrer Verpflegung, beispielsweise morgens mit einem »halben Liter abgekochtem, verdünnten Wasser«, welches Bier genannt würde. Mittags »gibt es Grünkohl mit Rüben und Kartoffeln – und den Geruch des Rindfleischs des Inspekteurs…« Eigentlich sind alle ganz zufrieden mit diesem neuen Heim, nur eine nicht und das ist Trine Bødkers. Und wie die sich wehrt und wie die anderen sich darauf wehren – das erzählt diese Geschichte mit einer sarkastischen Unerbittlichkeit.
In alphabetischer Reihenfolge: Philipp Botte, Randi Drümmer, Sarah Fengler, Jona Gola, Rebecca Jacobi, Mona Langhorst, Lara Ringel Fraile, Natalie Scheib, Julia Schmidt, André Wilkening, Alexander Witzko, Anastassis Zaltsberg. ↩