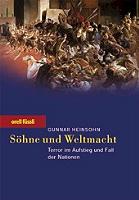Ich kenne diese öden, langweiligen Diskussionen, währenddessen friedliebende und sich einander respektierende Menschen in wenigen Augenblicken mutierten zu feindseligen, auf immer zerstritten mit denen, die sie noch vor wenigen Stunden Freunde genannt hatten: Es geht um das Pro und Contra dessen, was man (ungenau) Todesstrafe nennt und in den 70er und 80er Jahre das beliebteste Referendarsdiskussionsthema gewesen sein muss.
Konnte man doch in der sicheren Hülle einer demokratischen Gesellschaft seine politisch-korrekte Ächtung monstranzähnlich immer aufs Neue unter Beweis stellen und es all denjenigen zeigen, die sich der kategorischen Festlegung auf einer der scheinbar unverrückbaren Pole entziehen wollten (meistens versuchten sie dies anfangs argumentativ, um dann – nach kurzer Zeit – vom Wortschwall niedermoralisiert zu werden). Selektive Wahrnehmungen hatten auch damals schon Konjunktur.