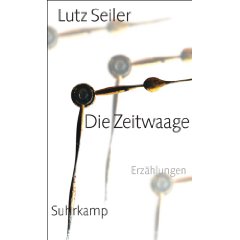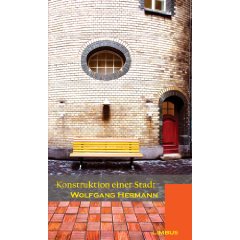»Turksib« in ziemlicher Einmütigkeit den Ingeborg-Bachmann-Preis zugesprochen bekam. Auch wenn man vielleicht einen anderen »Lieblingstext« im Wettbewerb hatte – die Qualität dieser Prosa war eindeutig und tatsächlich herausragend. Und noch heute erinnert man sich an diesen schaurig-zärtliche Loreley-Gesang des russischen (?) Heizers auf den rüttelnden Turksib-Gängen. Vielleicht ist dieser Fischgesang, der sich zwischen Erzähler und Heizer für eine schwer durchatmete Dauer ereignete, der Kristallisationspunkt dieser Erzählung, die ansonsten fast nur aus der Bewältigung des Ich-Erzählers der Strecke vom Zugende zum Zuganfang (oder ist es umgekehrt?) und der Beschau eines Geigerzählers (und vor allem dem Geräusch!) zu bestehen scheint. Aber – und dies wird noch Gegenstand der Erörterung sein – es ist nicht immer ganz leicht, den Movens der Erzählungen von Lutz Seiler »herauszuarbeiten«, was allerdings die Lektüre zusätzlich reizvoll macht.
Der vorliegende Band mit dem schönen, allegorischen Titel »Die Zeitwaage« (eine Zeitwaage ist ein Instrument zur Feststellung der Ganggenauigkeit einer Uhr) umfasst dreizehn Erzählungen (die Titelgeschichte findet sich am Ende des Buches). Sie weisen formal kein einheitliches Schema auf. Häufig gibt es einen Ich-Erzähler, der bisweilen durchaus (biografische) Parallelen mit dem Autor suggeriert (aber manchmal wird dieses übereifrige Germanistensuchen auch auf perfide Art plötzlich, innerhalb der Erzählung, gebrochen) und sogar, einmal (in der Erzählung »Gavroche«), werden Erzähler und Erzählung selber Gegenstand der Erzählung. Und in einigen Geschichten gibt es abweichend einen auktorialen Erzähler.
Bis auf die ersten beiden Geschichten (»Frank« und »Im Geräusch«), die durch die Protagonisten miteinander verbunden sind (sie sind auf Urlaub in den USA), »Turksib« und die »Zeitwaage« (Berlin) kann man als Ort Seilers Heimat Thüringen ausmachen. Und obwohl die Geschichten in der ehemaligen DDR mindestens verwurzelt sind, die Protagonisten ihre Sozialisation dort erfahren haben (zu allerdings durchaus unterschiedlichen Zeiten) und es durchaus Anspielungen auf Skurrilitäten und Absonderlichkeiten des Systems gibt (diese meist eher mit leichter Hand gezeichnet), ist die »Zeitwaage« kein »DDR-Buch«, schon gar kein Bewältigungsbuch. Die Verstörungen und Verletzungen der Figuren sind auf eine fast betörende Art Zeugnis eines aus-der-Welt-gefallen-Seins und besitzen einen merkwürdig hohen Grad an Universalität (die allerdings in keinem Fall mit Beliebigkeit verwechselt werden darf). Weiterlesen