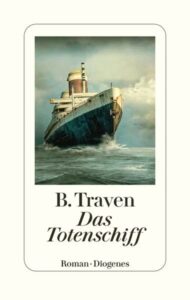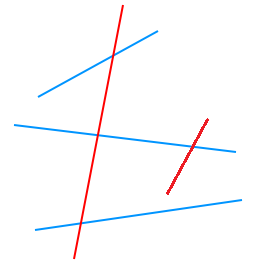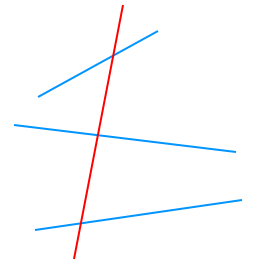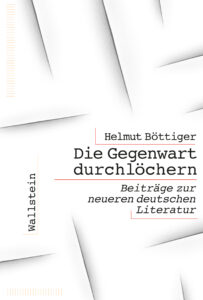
Nach dem gewissenhaft-historischen Aufriss über die Gruppe 47, einer eher launigen Revue über die Literatur der 1970er Jahre und einem reisereportagehaften Band über Czernowitz legt der Literaturkritiker Helmut Böttiger mit Die Gegenwart durchlöchern Werkportraits über fünfzehn Dichter vor, garniert mit seiner Rede zur Literaturkritik, die zwar auch schon mehr als zehn Jahre zurückliegt, aber nichts von ihrer Brisanz verloren hat und auf Samtpfoten, aber dennoch deutlich, den Unterschied zwischen Literaturjournalismus und Literaturkritik aufzeigt.
Zwar sind zehn der fünfzehn Autoren Büchnerpreisträger, dennoch fristen einige immer noch (bzw. wieder) ihr Los im Geheimtipp-Status. Obwohl auch Johannes Bobrowski (geboren in Tilsit) und Paul Celan (Czernowitz) vorgestellt werden, kann man guten Gewissens erklären, dass hier deutsche Autoren portraitiert werden (Österreicher und Schweizer kommen nicht vor). Böttiger weist in einem kurzen Hinweis, versteckt bei den Nachweisen, darauf hin, dass es sich nicht um den Versuch eines Kanons handeln soll.
Man entdeckt, dass sich der Kritiker teilweise mehrfach mit den entsprechenden Autoren beschäftigt hat. Die nun vorliegenden Aufsätze seien aus bestehenden Texten (entstanden zwischen 1995 und 2023) »allesamt erheblich ausgeweitet« und zu »Autorenporträts ausgestaltet« worden, so Böttiger. Erstaunlich, dass acht von diesen fünfzehn Autoren bereits 2004 in der bei Zsolnay erschienenen Textsammlung Nach den Utopien vorgestellt wurden. Auf einen Vergleich der Texte wurde verzichtet.
Die Länge der aktuellen Beiträge variiert zwischen 11 und 23 Seiten, aber selbst in den längeren Texten kämpft Böttiger zuweilen mit dem Material. Zum einen verzichtet er weitgehend auf als bekannt vorausgesetzte Lebenslaufführungen und widmet sich stattdessen den einschneidenden Prägungen, und deren literarische Verarbeitung. Zum anderen ist er aber immer wieder genötigt, kurze Inhaltsangaben zu Romanen oder Erzählungen abzugeben. Gelöst wird letzteres durch die Suche sich immer wiederkehrender Motive, die Rückschlüsse und Deutungen ermöglichen und Bögen spannen innerhalb eines Werkes. Häufig das Aufzeigen von Parallelen mit anderen Autoren. Dabei fällt auf, dass insbesondere Franz Kafka mehrmals genannt wird. Man fragt sich, ob die Tatsache, dass Wolfgang Hilbig tatsächlich Heizer war und sein Leben der Literatur aufging schon gleichbedeutend damit, dass er sich an Kafka orientiert?