Frank Bascombe ist 55 Jahre alt und wir befinden uns im Interregnum des Jahres 2000, als Clinton fast nicht mehr, Gore wohl doch nicht und Bush auch noch nicht ganz sicher Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Wir folgen ihm drei Tage im November bis Thanksgiving (am Ende gibt es eine kleine Ausnahme, als ein kleiner Zeitsprung erfolgt).
Bascombe hat als Immobilienmakler an der Ostküste von den fetten Jahren der Clinton-Wirtschaftspolitik enorm profitiert. Ein bisschen stört ihn dieser Hype schon, der selbst für heruntergekommene Häuser sechsstellige Dollarsummen erzielt (Amerika ist ein Land, das sich in einem eigenen Treuhandkonto verloren hat.). Und ein bisschen verschanzt sich Bascombe auch hinter einer Maske (Reinlassen, aber nicht ganz einlassen). Er ist Demokrat und seine Befürchtungen vor einer Regentschaft Bushs ist gross. Bascombe ist der oberen Mittelschicht zuzuordnen und teilt seine Kunden, Freunde, Passanten – kurz: fast alle Leute, mit denen er zu tun hat, in Republikaner oder Demokraten ein; ganz schlimm sein urteil über diejenigen, die er verdächtigt, Nader gewählt zu haben (denen wirft er – berechtigterweise – vor, indirekt Bush unterstützt zu haben).
Aber die Permanenzphase, jenes wohlige Gefühl, welches Status und Dauer (also pathetisch formuliert: Einklang mit sich und der Welt; Zufriedenheit) suggeriert, endet urplötzlich: Bascombe hat die typische amerikanische-Gegenwartsliteratur-Krankheit der männlichen Mittelschichtamerikaner »in den besten Jahren«: Prostatakrebs. Und das direkt nachdem seine zweite Frau ihn mit ihrem seit dreissig Jahren vermissten ersten Ehemann verlassen hatte. Im Gegensatz beispielsweise zu Philipp Roth dient Richard Ford diese Krankheit glücklicherweise nicht als Grund für allerlei peinliche viagraeske Oralsex- und Altherrenphantasien und/oder depressives Lamentieren. Obwohl die Behandlung mittels Seed-Implantation (die seine Tochter aus dem Internet als beste Möglichkeit herausgefunden hat; Ärzte kommen nicht so gut weg – mit Ausnahme seines Zahnarztes), das ständige, lästige Pinkeln und das Gefühl, mit diesen »Schrotkugeln« herumzulaufen, schon ein running-gag ist.
Und Bascombe (immerhin ein Sartre-Kenner und – so seine Selbstcharakterisierung – ein Essenzialist) kommt ans Denken; ihn treibt jetzt etwas um: Die Frage nach der inneren Substanz seines Lebens:
Doch angesichts meiner Lebensweise – immer auf dem offenen Meer, in Erwartung des fehlenden Viertels – hätte ich, so wurde mir klar, sterben können, und niemand hätte irgendeine besondere Erinnerung mit mir verbunden. ‘Ach, der Typ. Frank. äh. Genau. Hmmm…’ Das war ich. […] Es war ja nicht so, dass ich meine Initialen für immer und ewig in die Eichenrinde der Geschichte einbrennen wollte. Es sollte nur zumindest die Chance bestehen, dass nach meinem Ableben irgendwer (meine Kinder? Meine Exfrau?) meinen Namen nannte, und jemand anders sagte dann: ‘Richtig. Dieser Bascombe, Mann, der war immer ding.’ Oder: ‘Der alte Frank, der hat immer gerne ding. Oder, schlimmster Fall: ‘Himmel, dieser Bascombe, bin ich froh, dass jetzt endlich Schluss ist mit seinem grässlichen ding.’ Und jedes ding wäre ein menschlicher Zug von mir, den ich kannte und andere auch, und er würde mir gutgeschrieben, auch wenn er weder heldenhaft noch besonders grundlegend wäre.
Es ist ein grosses Verdienst von Richard Ford, dass er Bascombes gelegentlich aufkommende Melancholie weder herunterwitzelt noch in larmoyantes Säufergeschwafel abgleiten lässt noch als profane »Midlife-crisis« ausbreitet. Bascombes Touren (Ich-Erzählungen; weitgehend im Präsens) sind voller treffender Bemerkungen, gelungener Charakteristika und humoriger Aperçus. Er ist selbstironisch ohne Selbstmitleid, gelegentlich sarkastisch und glücklicherweise oft genug politisch nicht korrekt. Der Roman hat Stellen von toller Komik und auch grossem Ernst. Es gibt wunderbare und manchmal sogar poetische Bilder. Und ganz »nebenbei« zeigen uns Bascombes Beschreibungen die USA, wie sie uns ‑zig Artikel und Korrespondentenberichte niemals zeigen können. Da ist keine Seite zuviel. Ein grosses Lob an Frank Heibert für die sicherlich nicht immer einfache Übersetzung, denn das, was so scheinbar leicht (aber eben nicht seicht) daherkommt, ist oft genug das Schwerste.
Ford zeigt uns die fast schon vergessenen USA der Clinton-Ära, die auch für die Westeuropäer alles in allem so angenehm war, aber der Versuchung, mit dem Wissen von heute diese Zeit zu verklären, widersteht er glücklicherweise. Manchmal hat man das Gefühl, Bascombe steht sozusagen stellvertretend für sein Land – dann wäre beispielsweise sein Krebs eine Allegorie auf die Wahl, Bascombes Äusserungen zu den Jahren und Varianten des Sich-Abfindens wäre eine Prognose auf die in jeder Hinsicht katastrophalen Bush-Jahre und die martialische Szene am Ende des Buches (welche nicht verraten werden soll) eine Symbolik für den noch bevorstehenden 11. September. Aber da geht wohl der Interpretationsgaul mit dem Leser durch.
Ziemlich am Anfang der drei Tage geht Frank auf eine Beerdigung eines guten Freundes. Die Schilderungen sind voller Situationskomik – aber niemals nur eine Spur lächerlich. Er hört von dem Grabspruch seines Freundes und ärgert sich, nicht selber darauf gekommen zu sein: Fröhlich ertrug er die Narren. Und ganz am Schluss des Buches, wenn sich dann ein klein wenig kitschig alles wieder zurechtgefügt hat und Bascombe mit sich, seiner Frau und seinen Kindern wieder ins Reine gekommen ist, dann kommt er ans (vorläufige) Ende seines Philosophierens über sich und sein ding. Es geht wohl nicht anders – denn es gibt irgendwie die Notwendigkeit zu leben.
Und man möchte weiterlesen, was sonst noch passiert, aber da ist schon Schluss.
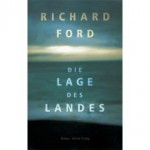
Sieht so aus, als käme man um Ford nicht herum. Diese Rezension macht auf jedenfalls an. Danke dafür.
Ich liebe Philip Roths Prostatabeschwerden! Auch seine Altherren Phantasien lese ich gern, da sie doch ziemlich schonungslos die Eitelkeiten, Gebrechen und Makel der alten Herren in seinen Büchern offen legen. Dank Roth hatte ich das erste Gespräch über Pornographie mit meinem Vater. Ich hatte ihm, mit vielen Warnhinweisen versehen, das Buch »Sabbath Theater« geliehen zusammen mit dem »menschlichen Makel«. Er hat es schließlich begeistert gelesen und wir kamen überein, dass, wenn man in das Buch hinein gefunden hat, die Beschreibung von Sabbaths Phantasien zum Verständnis der Person notwendig und authentisch sind. Uns beschäftigte natürlich die Frage Pornographie oder Kunst, ohne natürlich kontrovers zu werden, denn über die Meisterschaft von Roth waren wir uns einig.
Und jetzt also Ford...
Ja, sie macht an, Ihre Rezension! Nachdem ich bereits den ‘Sportreporter’ als eine
erzählerische ‘Offenbarung’ empfunden habe, werde ich das Buch in jedem Fall lesen.
Ich bin sehr gespannt...
#1 nerone – Tja, Roth...
ist das »Lieblingskind« auch der deutschen Literaturkritik. Ich habe das – ehrlich gesagt – nie verstanden. Das, was ich von ihm gelesen habe, war abschreckend; teilweise grässlich trivial. Die »Schonungslosigkeit«, die von der Kritik beispielsweise an »Mein Leben als Sohn« so hervorgehoben wurde, fand ich nur banal. Ich mag es nicht, wenn Figuren von ihren Autoren denunziert werden.
Die anderen Bücher, die ich von ihm gelesen habe (»Amerikanisches Idyll«, »Der menschliche Makel« und ein, zwei andere noch, die ich vergessen habe) haben mich in ihrer Aufgesetztheit entsetzlich gelangweilt. Wie ein Autor derart prämiert werden kann, erstaunt mich. Vermutlich bekommt er noch den Nobelpreis.
Ich kann mich den anderen Kommentatoren nur anschließen. Ihre Besprechung macht richtig Lust auf das Buch. Muss mir der nächste Besucher unbedingt mitbringen.
Bezüglich Roth: „Portnoys Beschwerden“ habe ich geradezu verschlungen. Alle anderen Roth-Bücher danach ließen mich völlig unbeeindruckt und meistens empfand ich sie sogar regelrecht langweilig. Der Enthusiasmus der Kritiken hat sich mir nie erschlossen.
Wenn man brav war, hat man ja den »Sportreporter« und »Unabhängigkeitstag«, die beiden Vorläufer zur »Lage des Landes« schon gelesen, also den Genuß insgesamt etwas länger erleben können.
Und ich dachte ich hätte eine schlimme Krankheit, dass ich Roth konstruiert und gewollt finde. Danke für das Bekenntnis. Der ewige Vergleich von Roth mit Updike, bringt mich jedes Jahr vor der Nobelpreisverleihung um den Verstand.
Kommt es mir eigentlich nur so vor oder dominiert die amerikanische Literatur mittlerweile auch die europäische Bühne? Schleichend.